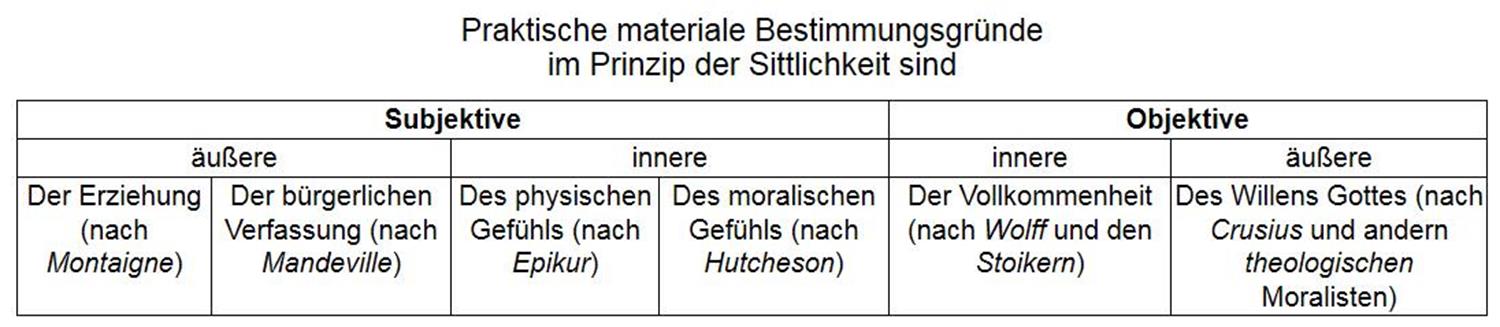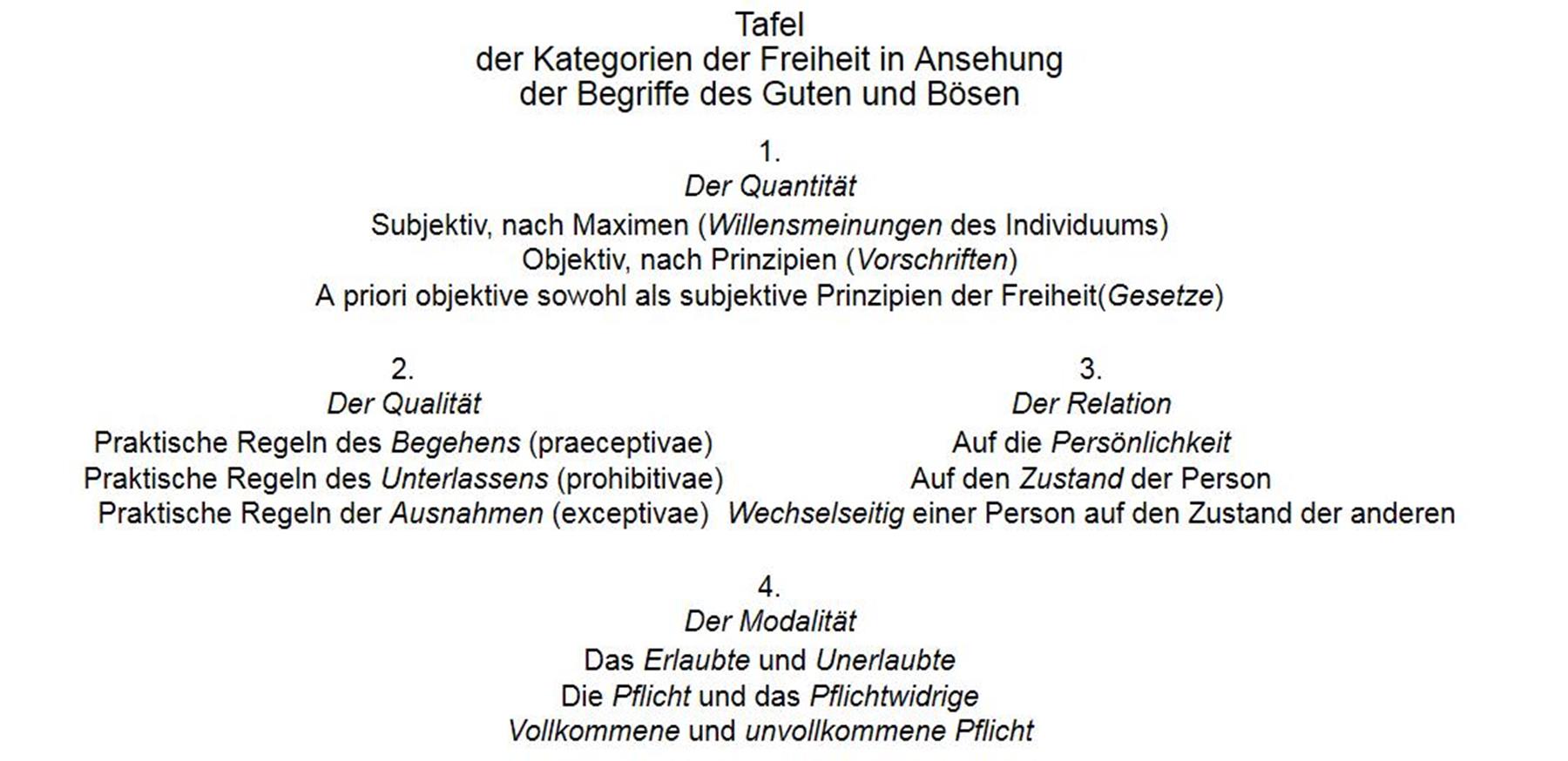Kritik der praktischen Vernunft TEIL 1
Immanuel Kant (1781)
Elementarlehre der reinen praktischen Vernunft
Erstes Buch Die Analytik der reinen praktischen Vernunft
Erstes Hauptstück Von den Grundsätzen der reinen praktischen Vernunft
Erklärung
Praktische Grundsätze sind Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten, die mehrere praktische Regeln unter sich hat. Sie sind subjektiv, oder Maximen, wenn die Bedingung nur als für den Willen des Subjekts gültig von ihm angesehen wird; objektiv aber, oder praktische Gesetze, wenn jene als objektiv, d.h. für den Willen jedes vernünftigen Wesens gültig erkannt wird.
Anmerkung
Wenn man annimmt, dass reine Vernunft einen praktischen, d.h. zur Willensbestimmung hinreichenden Grund in sich enthalten könne, so gibt es praktische Gesetze; wo aber nicht, so werden alle praktische Grundsätze bloße Maximen sein. In einem pathologisch-affizierten Willen eines vernünftigen Wesens kann ein Widerstreit der Maximen, wider die von ihm selbst erkannten praktischen Gesetze, angetroffen werden. Z.B. es kann sich jemand zur Maxime machen, keine Beleidigung ungerächt zu erdulden, und doch zugleich einsehen, dass dieses kein praktisches Gesetz, sondern nur seine Maxime sei, dagegen, als Regel für den Willen eines jeden vernünftigen Wesens, in einer und derselben Maxime, mit sich selbst nicht zusammen stimmen könne.
In der Naturerkenntnis sind die Prinzipien dessen, was geschieht (z.B. das Prinzip der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung in der Mitteilung der Bewegung), zugleich Gesetze der Natur; denn der Gebrauch der Vernunft ist dort theoretisch und durch die Beschaffenheit des Objekts bestimmt. In der praktischen Erkenntnis d.h. diejenige welche es bloß mit Bestimmungsgründen des Willens zu tun hat, sind Grundsätze, die man sich macht, darum noch nicht Gesetze, darunter man unvermeidlich stehe, weil die Vernunft im Praktischen es mit dem Subjekt zu tun hat, nämlich dem Begehrungsvermögen, nach dessen besonderer Beschaffenheit sich die Regel vielfältig richten kann. Die praktische Regel ist jederzeit ein Produkt der Vernunft, weil sie Handlung, als Mittel zur Wirkung, als Absicht vorschreibt. Diese Regel ist aber für ein Wesen, bei dem Vernunft nicht ganz allein Bestimmungsgrund des Willens ist, ein Imperativ, d.h. eine Regel, die durch ein Sollen, welches die objektive Nötigung der Handlung ausdrückt, bezeichnet wird, und bedeutet, dass, wenn die Vernunft den Willen gänzlich bestimme, die Handlung unausbleiblich nach dieser Regel geschehen würde.
Die Imperativen gelten also objektiv, und sind von Maximen, als subjektiven Grundsätzen, gänzlich unterschieden. Jene bestimmen aber entweder die Bedingungen der Kausalität des vernünftigen Wesens als wirkender Ursache, bloß in Ansehung der Wirkung und Zulänglichkeit zu derselben, oder sie bestimmen nur den Willen, er mag zur Wirkung hinreichend sein oder nicht. Die ersteren würden hypothetische Imperativen sein, und bloße Vorschriften der Geschicklichkeit enthalten; die zweiten würden dagegen kategorisch und allein praktische Gesetze sein. Maximen sind also zwar Grundsätze, aber nicht Imperativen. Die Imperativen selber aber, wenn sie bedingt sind, d.h. nicht den Willen schlechthin als Willen, sondern nur in Ansehung einer begehrten Wirkung bestimmen, d.h. hypothetische Imperativen sind, sind zwar praktische Vorschriften, aber keine Gesetze. Die letzteren müssen den Willen als Willen, noch ehe ich frage, ob ich gar das zu einer begehrten Wirkung erforderliche Vermögen habe, oder, was mir, um diese hervorzubringen, zu tun sei, hinreichend bestimmen, mithin kategorisch sein, sonst sind es keine Gesetze; weil ihnen die Notwendigkeit fehlt, welche, wenn sie praktisch sein soll, von pathologischen, mithin dem Willen zufällig anklebenden Bedingungen unabhängig sein muss. Sagt jemandem z.B., dass er in der Jugend arbeiten und sparen müsse, um im Alter nicht zu darben, so ist dieses eine richtige und zugleich wichtige praktische Vorschrift des Willens. Man sieht aber leicht, dass der Wille hier auf etwas anderes verwiesen werde, wovon man voraussetzt, dass er es begehre, und dieses Begehren muss man ihm, dem Täter selbst, überlassen, ob er noch andere Hilfsquellen, außer seinem selbst erworbenen Vermögen, vorhersehe, oder ob er gar nicht hoffe, alt zu werden, oder sich denkt im Falle der Not dereinst schlecht behelfen zu können.
Die Vernunft, aus der allein alle Regel, die Notwendigkeit enthalten soll, entspringen kann, legt in diese ihre Vorschrift zwar auch Notwendigkeit (denn ohne das wäre sie kein Imperativ), aber diese ist nur subjektiv bedingt, und man kann sie nicht in allen Subjekten in gleichem Grade voraussetzen. Zu ihrer Gesetzgebung aber wird erfordert, dass sie bloß sich selbst vorauszusetzen bedürfe, weil die Regel nur alsdann objektiv und allgemein gültig ist, wenn sie ohne zufällige, subjektive Bedingungen gilt, die ein vernünftiges Wesen von dem anderen unterscheidet.
Nun sagt jemandem, er solle niemals lügenhaft versprechen, so ist dies eine Regel, die bloß seinen Willen betrifft; die Absichten, die der Mensch haben mag, mögen durch denselben erreicht werden können, oder nicht, das bloße Wollen ist das, was durch jene Regel völlig a priori bestimmt werden soll. Findet sich nun, dass diese Regel praktisch richtig sei, so ist sie ein Gesetz, weil sie ein kategorischer Imperativ ist. Also beziehen sich praktische Gesetze allein auf den Willen, unangesehen dessen, was durch die Kausalität desselben ausgerichtet wird, und man kann von der letzteren (als zur Sinnenwelt gehörig) abstrahieren, um sie rein zu haben.
Lehrsatz I
Alle praktischen Prinzipien, die ein Objekt (Materie) des Begehrungsvermögens, als Bestimmungsgrund des Willens, voraussetzen, sind insgesamt empirisch und können keine praktischen Gesetze abgeben.
Ich verstehe unter der Materie des Begehrungsvermögens einen Gegenstand, dessen Wirklichkeit begehrt wird. Wenn die Begierde nach diesem Gegenstand nun vor der praktischen Regel vorhergeht, und die Bedingung ist, sie sich zum Prinzip zu machen, so sage ich (erstens), dieses Prinzip ist alsdann jederzeit empirisch. Denn der Bestimmungsgrund der Willkür ist alsdann die Vorstellung eines Objekts, und dasjenige Verhältnis derselben zum Subjekt, wodurch das Begehrungsvermögen zur Wirklichmachung desselben bestimmt wird. Ein solches Verhältnis aber zum Subjekt heißt die Lust an der Wirklichkeit eines Gegenstandes. Also müsste diese als Bedingung der Möglichkeit der Bestimmung der Willkür vorausgesetzt werden. Es kann aber von keiner Vorstellung irgendeines Gegenstandes, welche sie auch sei, a priori erkannt werden, ob sie mit Lust oder Unlust verbunden, oder indifferent sein werde. Also muss in solchem Falle der Bestimmungsgrund der Willkür jederzeit empirisch sein, mithin auch das praktische materiale Prinzip, welches ihn als Bedingung voraussetzte.
Da nun (zweitens) ein Prinzip, das sich nur auf die subjektive Bedingung der Empfänglichkeit einer Lust oder Unlust (die jederzeit nur empirisch erkannt, und nicht für alle vernünftigen Wesen in gleicher Art gültig sein kann) gründet, zwar wohl für das Subjekt, das sie besitzt, zu ihrer Maxime, aber auch für diese selbst (weil es ihm an objektiver Notwendigkeit, die a priori erkannt werden muss, mangelt) nicht zum Gesetz dienen kann, so kann ein solches Prinzip niemals ein praktisches Gesetz abgeben.
Lehrsatz II
Alle materialen praktischen Prinzipien sind, als solche, insgesamt von einer und derselben Art und gehören unter das allgemeine Prinzip der Selbstliebe oder eigenen Glückseligkeit. Die Lust aus der Vorstellung der Existenz einer Sache, sofern sie ein Bestimmungsgrund des Begehrens dieser Sache sein soll, gründet sich auf der Empfänglichkeit des Subjekts, weil sie von dem Dasein eines Gegenstandes abhängt; mithin gehört sie dem Sinn (Gefühl) und nicht dem Verstand an, der eine Beziehung der Vorstellung auf ein Objekt, nach Begriffen, aber nicht auf das Subjekt, nach Gefühlen, ausdrückt. Sie ist also nur sofern praktisch, als die Empfindung der Annehmlichkeit, die das Subjekt von der Wirklichkeit des Gegenstandes erwartet, das Begehrungsvermögen bestimmt. Nun ist aber das Bewusstsein eines vernünftigen Wesens von der Annehmlichkeit des Lebens, die ununterbrochen sein ganzes Dasein begleitet, die Glückseligkeit, und das Prinzip, diese sich zum höchsten Bestimmungsgrunde der Willkür zu machen, das Prinzip der Selbstliebe. Also sind alle materialen Prinzipien, die den Bestimmungsgrund der Willkür in der, aus irgendeines Gegenstandes Wirklichkeit zu empfindenden Lust oder Unlust setzen, so fern gänzlich von einerlei Art, dass sie insgesamt zum Prinzip der Selbstliebe, oder eigenen Glückseligkeit gehören.
Folgerung
Alle materialen praktischen Regeln setzen den Bestimmungsgrund des Willens im unteren Begehrungsvermögen, und gäbe es gar keine bloß formalen Gesetze desselben, die den Willen hinreichend bestimmten, so würde auch kein oberes Begehrungsvermögen eingeräumt werden können.
Anmerkung I
Man muss sich wundern, wie sonst scharfsinnige Männer einen Unterschied zwischen dem unteren und oberen Begehrungsvermögen darin zu finden glauben können, ob die Vorstellungen, die mit dem Gefühl der Lust verbunden sind, in den Sinnen oder dem Verstande ihren Ursprung haben. Denn es kommt, wenn man nach den Bestimmungsgründen des Begehrens fragt und sie in einer von irgendetwas erwarteten Annehmlichkeit setzt, gar nicht darauf an, wo die Vorstellung dieses vergnügenden Gegenstandes herkomme, sondern nur, wie sehr sie vergnügt.
Wenn eine Vorstellung, sie mag immerhin im Verstande ihren Sitz und Ursprung haben, die Willkür nur dadurch bestimmen kann, dass sie ein Gefühl einer Lust im Subjekte voraussetzt, so ist, dass sie ein Bestimmungsgrund der Willkür sei, gänzlich von der Beschaffenheit des inneren Sinnes abhängig, dass dieser nämlich dadurch mit Annehmlichkeit affiziert werden kann. Die Vorstellungen der Gegenstände mögen noch so ungleichartig, sie mögen Verstandes-, selbst Vernunftvorstellungen im Gegensatze der Vorstellungen der Sinne sein, so ist doch das Gefühl der Lust, wodurch jene doch eigentlich nur den Bestimmungsgrund des Willens ausmachen (die Annehmlichkeit, das Vergnügen, das man davon erwartet, welches die Tätigkeit zur Hervorbringung des Objekts antreibt), nicht allein so fern von einerlei Art, dass es jederzeit bloß empirisch erkannt werden kann, sondern auch so fern, als er eine und dieselbe Lebenskraft, die sich im Begehrungsvermögen äußert, affiziert, und in dieser Beziehung von jedem anderen Bestimmungsgrunde in nichts, als dem Grade, verschieden sein kann. Wie würde man ansonsten zwischen zwei der Vorstellungsart nach gänzlich verschiedenen Bestimmungsgründen eine Vergleichung der Größe nach anstellen können, um den, der am meisten das Begehrungsvermögen affiziert, vorzuziehen? Eben derselbe Mensch kann ein ihm lehrreiches Buch, das ihm nur einmal zu Händen kommt, ungelesen zurückgeben, um die Jagd nicht zu versäumen, in der Mitte einer schönen Rede weggehen, um zur Mahlzeit nicht zu spät zu kommen, eine Unterhaltung durch vernünftige Gespräche, die er sonst sehr schätzt, verlassen, um sich an den Spieltisch zu setzen, sogar einen Armen, dem wohlzutun ihm sonst Freude ist, abweisen, weil er jetzt eben nicht mehr Geld in der Tasche hat, als er braucht, um den Eintritt in die Komödie zu bezahlen.
Beruht die Willensbestimmung auf dem Gefühl der Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit, die er aus irgendeiner Ursache erwartet, so ist es ihm gänzlich einerlei, durch welche Vorstellungsart er affiziert werde. Nur wie stark, wie lange, wie leicht erworben und oft wiederholt diese Annehmlichkeit sei, daran liegt es ihm, um sich zur Wahl zu entschließen. So wie demjenigen, der Gold zur Ausgabe braucht, gänzlich einerlei ist, ob die Materie desselben, das Gold, aus dem Gebirge gegraben oder aus dem Sande gewaschen ist, wenn es nur allenthalben für denselben Wert angenommen wird, so fragt kein Mensch, wenn es ihm bloß an der Annehmlichkeit des Lebens gelegen ist, ob Verstandes oder Sinnesvorstellungen, sondern nur, wie viel und großes Vergnügen sie ihm auf die längste Zeit verschaffen.
Nur diejenigen, welche der reinen Vernunft das Vermögen, ohne Voraussetzung irgendeines Gefühls den Willen zu bestimmen, gerne abstreiten möchten, können sich so weit von ihrer eigenen Erklärung verirren, das, was sie selbst vorher auf ein und eben dasselbe Prinzip gebracht haben, dennoch hernach für ganz ungleichartig zu erklären. So findet sich z.B., dass man auch an bloßer Kraftanwendung, an dem Bewusstsein seiner Seelenstärke in Überwindung der Hindernisse, die sich unserem Vorsatze entgegensetzen, an der Kultur der Geistestalente, usw., Vergnügen finden könne, und wir nennen das mit Recht feinere Freuden und Ergötzungen, weil sie mehr, wie andere, in unserer Gewalt sind, sich nicht abnutzen, das Gefühl zu noch mehrerem Genuss derselben vielmehr stärken, und, indem sie ergötzen, zugleich kultivieren. Allein sie darum für eine andere Art, den Willen zu bestimmen, als bloß durch den Sinn, auszugeben, da sie doch einmal, zur Möglichkeit jener Vergnügen, ein darauf in uns angelegtes Gefühl als erste Bedingung dieses Wohlgefallens, voraussetzen, ist gerade so, als wenn Unwissende, die gerne in der Metaphysik pfuschen möchten, sich die Materie so fein, so überfein, dass sie selbst darüber schwindlig werden möchten, denken, und dann glauben, auf diese Art sich ein geistiges und doch ausgedehntes Wesen erdacht zu haben.
Wenn wir es, mit dem Epikur, bei der Tugend aufs bloße Vergnügen aussetzen, das sie verspricht, um den Willen zu bestimmen, so können wir ihn hernach nicht tadeln, dass er dieses mit denen der gröbsten Sinne für ganz gleichartig hält; denn man hat gar nicht Grund, ihm aufzubürden, dass er die Vorstellungen, wodurch dieses Gefühl in uns erregt würde, bloß den körperlichen Sinnen beigemessen hätte. Er hat von vielen derselben den Quell, so viel man erraten kann, eben sowohl in dem Gebrauch des höheren Erkenntnisvermögens gesucht; aber das hinderte ihn nicht und konnte ihn auch nicht hindern, nach genanntem Prinzip das Vergnügen selbst, das uns jene allenfalls intellektuellen Vorstellungen gewähren, und wodurch sie allein Bestimmungsgründe des Willens sein können, gänzlich für gleichartig zu halten. Konsequent zu sein, ist die größte Obliegenheit eines Philosophen, und wird doch am seltensten angetroffen. Die alten griechischen Schulen geben uns davon mehr Beispiele, als wir in unserem synkretistischen Zeitalter antreffen, wo ein gewisses Koalitionssystem widersprechender Grundsätze voll Unredlichkeit und Seichtigkeit erkünstelt wird, weil es sich einem Publikum besser empfiehlt, das zufrieden ist, von allem etwas, und im ganzen nichts zu wissen, und dabei in allen Sätteln gerecht zu sein.
Das Prinzip der eigenen Glückseligkeit, so viel Verstand und Vernunft bei ihm auch gebraucht werden mag, würde doch für den Willen keine anderen Bestimmungsgründe, als die dem unteren Begehrungsvermögen angemessen sind, in sich fassen, und es gibt also entweder gar kein Begehrungsvermögen oder reine Vernunft muss für sich allein praktisch sein, d.h. ohne Voraussetzung irgendeines Gefühls, mithin ohne Vorstellungen des Angenehmen oder Unangenehmen, als der Materie des Begehrungsvermögens, die jederzeit eine empirische Bedingung der Prinzipien ist, durch die bloße Form der praktischen Regel den Willen bestimmen können.
Alsdann allein ist Vernunft nur, sofern sie für sich selbst den Willen bestimmt (nicht im Dienste der Neigungen ist), ein wahres oberes Begehrungsvermögen, dem das pathologisch bestimmbare untergeordnet ist, und wirklich, ja spezifisch von diesem unterschieden, so dass sogar die mindeste Beimischung von den Antrieben der letzteren ihrer Stärke und Vorzüge Abbruch tut, so wie das mindeste Empirische, als Bedingung in einer mathematischen Demonstration, ihre Würde und Nachdruck herabsetzt und vernichtet. Die Vernunft bestimmt in einem praktischen Gesetze unmittelbar den Willen, nicht vermittelst eines dazwischen kommenden Gefühls der Lust und Unlust, selbst nicht an diesem Gesetze, und nur, dass sie als reine Vernunft praktisch sein kann, macht es ihr möglich, gesetzgebend zu sein.
Anmerkung II
Glücklich zu sein ist notwendig, das Verlangen jedes vernünftigen aber endlichen Wesens, und also ein unvermeidlicher Bestimmungsgrund seines Begehrungsvermögens. Denn die Zufriedenheit mit seinem ganzen Dasein ist nicht etwa ein ursprünglicher Besitz, und eine Seligkeit, welche ein Bewusstsein seiner unabhängigen Selbstgenügsamkeit voraussetzen würde, sondern ein durch seine endliche Natur selbst ihm aufgedrungenes Problem, weil es bedürftig ist, und dieses Bedürfnis betrifft die Materie seines Begehrungsvermögens, d.h. etwas, was sich auf ein subjektiv zu Grunde liegendes Gefühl der Lust oder Unlust bezieht, dadurch das, was es zur Zufriedenheit mit seinem Zustande bedarf, bestimmt wird. Aber eben darum, weil dieser materiale Bestimmungsgrund von dem Subjekt bloß empirisch erkannt werden kann, ist es unmöglich, diese Aufgabe als ein Gesetz zu betrachten, weil dieses als objektiv in allen Fällen und für alle vernünftige Wesen eben denselben Bestimmungsgrund des Willens enthalten müsste. Denn obgleich der Begriff der Glückseligkeit der praktischen Beziehung der Objekte aufs Begehrungsvermögen allerwärts zu Grunde liegt, so ist er doch nur der allgemeine Titel der subjektiven Bestimmungsgründe, und bestimmt nicht spezifisch, darum es doch in dieser praktischen Aufgabe allein zu tun ist, und ohne welche Bestimmung sie gar nicht aufgelöset werden kann.
Worin nämlich jeder seine Glückseligkeit zu setzen habe, kommt auf jedes seines besonderen Gefühls der Lust und Unlust an, und selbst in einem und demselben Subjekt auf die Verschiedenheit der Bedürfnisse, nach den Abänderungen dieses Gefühls, und ein subjektiv notwendiges Gesetz (als Naturgesetz) ist also objektiv ein gar sehr zufälliges praktisches Prinzip, das in verschiedenen Subjekten sehr verschieden sein kann und muss, mithin niemals ein Gesetz abgeben kann, weil es, bei der Begierde nach Glückseligkeit, nicht auf die Form der Gesetzmäßigkeit, sondern lediglich auf die Materie ankommt, nämlich ob und wie viel Vergnügen ich in der Befolgung des Gesetzes zu erwarten habe.
Prinzipien der Selbstliebe können zwar allgemeine Regeln der Geschicklichkeit (Mittel zu Absichten auszufinden) enthalten, alsdann sind es aber bloß theoretische Prinzipien, (z.B. wie derjenige, der gerne Brot essen möchte, sich eine Mühle auszudenken habe). Aber praktische Vorschriften, die sich auf sie gründen, können niemals allgemein sein, denn der Bestimmungsgrund des Begehrungsvermögens ist auf das Gefühl der Lust und Unlust, das niemals als allgemein, auf dieselben Gegenstände gerichtet, angenommen werden kann, gegründet. Aber gesetzt, endliche vernünftige Wesen dächten auch in Ansehung dessen, was sie für Objekte ihrer Gefühle des Vergnügens oder Schmerzens anzunehmen hätten, im gleichen sogar in Ansehung der Mittel, deren sie sich bedienen müssen, um die ersteren zu erreichen, die andern abzuhalten, durchgehend einerlei, so würde das Prinzip der Selbstliebe dennoch von ihnen durchaus für kein praktisches Gesetz ausgegeben werden können; denn diese Einhelligkeit wäre selbst doch nur zufällig. Der Bestimmungsgrund wäre immer doch nur subjektiv gültig und bloß empirisch, und hätte diejenige Notwendigkeit nicht, die in einem jeden Gesetze gedacht wird, nämlich die objektive aus Gründen a priori; man müsste denn diese Notwendigkeit gar nicht für praktisch, sondern für bloß physisch ausgeben, nämlich dass die Handlung durch unsere Neigung uns ebenso unausbleiblich abgenötigt würde, als das Gähnen, wenn wir andere gähnen sehen.
Man würde eher behaupten können, dass es gar keine praktischen Gesetze gebe, sondern nur Anratungen zum Zweck unserer Begierden, als dass bloß subjektive Prinzipien zum Range praktischer Gesetze erhoben würden, die durchaus objektive und nicht bloß subjektive Notwendigkeit haben, und durch Vernunft a priori, nicht durch Erfahrung (so empirisch allgemein diese auch sein mag) erkannt sein müssen. Selbst die Regeln einstimmiger Erscheinungen werden nur Naturgesetze (z.B. die mechanischen) genannt, wenn man sie entweder wirklich a priori erkennt, oder doch (wie bei den chemischen) annimmt, sie würden a priori aus objektiven Gründen erkannt werden, wenn unsere Einsicht tiefer ginge. Allein bei bloß subjektiven praktischen Prinzipien wird das ausdrücklich zur Bedingung gemacht, dass ihnen nicht objektive, sondern subjektive Bedingungen der Willkür zu Grunde liegen müssen; mithin, dass sie jederzeit nur als bloße Maximen, niemals aber als praktische Gesetze, vorstellig gemacht werden dürfen. Diese letztere Anmerkung scheint beim ersten Anblicke bloße Wortklauberei zu sein; allein die Wortbestimmung des allerwichtigsten Unterschiedes, der nur in praktischen Untersuchungen in Betrachtung kommen mag.
Lehrsatz III
Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als praktische allgemeine Gesetze denken soll, so kann es sich dieselben nur als solche Prinzipien denken, die, nicht der Materie, sondern bloß der Form nach, den Bestimmungsgrund des Willens enthalten.
Die Materie eines praktischen Prinzips ist der Gegenstand des Willens. Dieser ist entweder der Bestimmungsgrund des letzteren, oder nicht. Ist er der Bestimmungsgrund desselben, so würde die Regel des Willens einer empirischen Bedingung (dem Verhältnisse der bestimmenden Vorstellung zum Gefühle der Lust und Unlust) unterworfen, folglich kein praktisches Gesetz sein. Nun bleibt von einem Gesetz wenn man alle Materie, d.h. jeden Gegenstand des Willens (als Bestimmungsgrund) davon absondert, nichts übrig, als die bloße Form einer allgemeinen Gesetzgebung. Also kann ein vernünftiges Wesen sich seine subjektiv-praktischen Prinzipien, d.h. Maximen, entweder gar nicht zugleich als allgemeine Gesetze denken, oder es muss annehmen, dass die bloße Form derselben, nach der jene sich zur allgemeinen Gesetzgebung schicken, sie für sich allein zum praktischen Gesetz mache.
Anmerkung III
Welche Form in der Maxime sich zur allgemeinen Gesetzgebung schicke, welche nicht, das kann der gemeinste Verstand ohne Unterweisung unterscheiden. Ich habe z.B. es mir zur Maxime gemacht, mein Vermögen durch alle sicheren Mittel zu vergrößern. Jetzt ist ein Depositum in meinen Händen, dessen Eigentümer verstorben ist und keine Handschrift darüber zurückgelassen hat. Natürlicherweise ist dies der Fall meiner Maxime. Jetzt will ich nur wissen, ob jene Maxime auch als allgemeines praktisches Gesetz gelten könne. Ich wende jene also auf gegenwärtigen Fall an, und frage, ob sie wohl die Form eines Gesetzes annehmen, mithin ich wohl durch meine Maxime zugleich ein solches Gesetz geben könnte, dass jedermann ein Depositum ableugnen dürfe, dessen Niederlegung ihm niemand beweisen kann. Ich werde sofort gewahr, dass ein solches Prinzip, als Gesetz, sich selbst vernichten würde, weil es machen würde, dass es gar kein Depositum gäbe. Ein praktisches Gesetz, was ich dafür erkenne, muss sich zur allgemeinen Gesetzgebung qualifizieren; dies ist ein identischer Satz und also für sich klar. Sage ich nun, mein Wille steht unter einem praktischen Gesetz so kann ich nicht meine Neigung (z.B. im gegenwärtigen Falle meine Habsucht) als den zu einem allgemeinen praktischen Gesetze schicklichen Bestimmungsgrund desselben anführen; denn diese, weit gefehlt, dass sie zu einer allgemeinen Gesetzgebung tauglich sein sollte, so muss sie vielmehr in der Form eines allgemeinen Gesetzes sich selbst aufreiben.
Es ist daher wunderlich, wie, da die Begierde zur Glückseligkeit, mithin auch die Maxime, dadurch sich jeder diese letztere zum Bestimmungsgrunde seines Willens setzt, allgemein ist, es verständigen Männern habe in den Sinn kommen können, es darum für ein allgemein praktisches Gesetz auszugeben. Denn da sonst ein allgemeines Naturgesetz alles einstimmig macht, so würde hier, wenn man der Maxime die Allgemeinheit eines Gesetzes geben wollte, grade das äußerste Widerspiel der Einstimmung, der ärgste Widerstreit und die gänzliche Vernichtung der Maxime selbst und ihrer Absicht erfolgen. Denn der Wille aller hat alsdann nicht ein und dasselbe Objekt, sondern ein jeder hat das seinige (sein eigenes Wohlbefinden), welches sich zwar, zufälligerweise, auch mit anderer ihren Absichten, die sie gleichfalls auf sich selbst richten, vertragen kann, aber lange nicht zum Gesetz hinreichend ist, weil die Ausnahmen, die man gelegentlich zu machen befugt ist, endlos sind, und gar nicht bestimmt in eine allgemeine Regel befasst werden können. Es kommt auf diese Art eine Harmonie heraus, die derjenigen ähnlich ist, welche ein gewisses Spottgedicht auf die Seeleneintracht zweier sich zu Grunde richtenden Eheleute schildert: O wundervolle Harmonie, was er will, will auch sie etc., oder was von der Anheischigmachung König Franz des Ersten gegen Kaiser Karl den Fünften erzählt wird: was mein Bruder Karl haben will (Mailand), das will ich auch haben. Empirische Bestimmungsgründe taugen zu keiner allgemeinen äußeren Gesetzgebung, aber auch ebenso wenig zur inneren; denn jeder legt sein Subjekt, ein anderer aber ein anderes Subjekt der Neigung zu Grunde, und in jedem Subjekt selber ist bald die, bald eine andere im Vorzuge des Einflusses. Ein Gesetz ausfindig zu machen, das sie insgesamt unter dieser Bedingung, nämlich mit allerseitiger Einstimmung, regierte, ist schlechterdings unmöglich.
Aufgabe I
Vorausgesetzt, dass die bloße gesetzgebende Form der Maximen allein der zureichende Bestimmungsgrund eines Willens sei, die Beschaffenheit desjenigen Willens zu finden, der dadurch allein bestimmbar ist.
Da die bloße Form des Gesetzes lediglich von der Vernunft vorgestellt werden kann, und mithin kein Gegenstand der Sinne ist, folglich auch nicht unter die Erscheinungen gehört, so ist die Vorstellung derselben als Bestimmungsgrund des Willens von allen Bestimmungsgründen der Begebenheiten in der Natur nach dem Gesetze der Kausalität unterschieden, weil bei diesen die bestimmenden Gründe selbst Erscheinungen sein müssen. Wenn aber auch kein anderer Bestimmungsgrund des Willens für diesen zum Gesetz dienen kann, als bloß jene allgemeine gesetzgebende Form. So muss ein solcher Wille als gänzlich unabhängig von dem Naturgesetz der Erscheinungen, nämlich dem Gesetze der Kausalität, beziehungsweise auf einander, gedacht werden. Eine solche Unabhängigkeit aber heißt Freiheit im strengsten, d.h. transzendentalen Verstande. Also ist ein Wille, dem die bloße gesetzgebende Form der Maxime allein zum Gesetze dienen kann, ein freier Wille.
Aufgabe II
Vorausgesetzt, dass ein Wille frei sei, das Gesetz zu finden, welches ihn allein notwendig zu bestimmen tauglich ist.
Da die Materie des praktischen Gesetzes, d.h. ein Objekt der Maxime, niemals anders als empirisch gegeben werden kann, der freie Wille aber, als von empirischen (d.h. zur Sinnenwelt gehörigen) Bedingungen unabhängig, dennoch bestimmbar sein muss, so muss ein freier Wille, unabhängig von der Materie des Gesetzes, dennoch einen Bestimmungsgrund in dem Gesetze antreffen. Es ist aber, außer der Materie des Gesetzes, nichts weiter in demselben, als die gesetzgebende Form enthalten. Also ist die gesetzgebende Form, sofern sie in der Maxime enthalten ist, das Einzige, was einen Bestimmungsgrund des Willens ausmachen kann.
Anmerkung
Freiheit und unbedingtes praktisches Gesetz weisen also wechselsweise aufeinander zurück. Ich frage hier nun nicht, ob sie auch in der Tat verschieden sein, und nicht vielmehr ein unbedingtes Gesetz bloß das Selbstbewusstsein einer reinen praktischen Vernunft, diese aber ganz einerlei mit dem positiven Begriffe der Freiheit sei; sondern wovon unsere Erkenntnis des unbedingt-Praktischen anhebe, ob von der Freiheit, oder dem praktischen Gesetze. Von der Freiheit kann es nicht anheben; denn deren können wir uns weder unmittelbar bewusst werden, weil sein erster Begriff negativ ist, noch darauf aus der Erfahrung schließen, denn Erfahrung gibt uns nur das Gesetz der Erscheinungen, mithin den Mechanismus der Natur, das gerade Widerspiel der Freiheit, zu erkennen. Also ist es das moralische Gesetz, dessen wir uns unmittelbar bewusst werden (sobald wir uns Maximen des Willens entwerfen), welches sich uns zuerst darbietet, und, indem die Vernunft jenes als einen durch keine sinnliche Bedingungen zu überwiegenden, ja davon gänzlich unabhängigen Bestimmungsgrund darstellt, gerade auf den Begriff der Freiheit führt.
Wie ist aber auch das Bewusstsein jenes moralischen Gesetzes möglich? Wir können uns reiner praktischer Gesetze bewusst werden, ebenso, wie wir uns reiner theoretischer Grundsätze bewusst sind, indem wir auf die Notwendigkeit, womit sie uns die Vernunft vorschreibt, und auf Absonderung aller empirischen Bedingungen, dazu uns jene hinweist, Acht haben. Der Begriff eines reinen Willens entspringt aus den ersteren, wie das Bewusstsein eines reinen Verstandes aus dem letzteren. Dass dieses die wahre Unterordnung unserer Begriffe sei, und Sittlichkeit uns zuerst den Begriff der Freiheit entdecke, mithin praktische Vernunft zuerst der spekulativen das unauflöslichste Problem mit diesem Begriffe aufstelle, um sie durch denselben in die größte Verlegenheit zu setzen, erhellt schon daraus, dass, da aus dem Begriffe der Freiheit in den Erscheinungen nichts erklärt werden kann, sondern hier immer Naturmechanismen den Leitfaden ausmachen muss, überdem auch die Antinomie der reinen Vernunft, wenn sie zum Unbedingten in der Reihe der Ursachen aufsteigen will, sich, bei einem so sehr wie bei dem andern, in Unbegreiflichkeiten verwickelt, indessen dass doch der letztere (Mechanismus ) wenigstens Brauchbarkeit in Erklärung der Erscheinungen hat, man niemals zu dem Wagstücke gekommen sein würde, Freiheit in die Wissenschaft einzuführen, wäre nicht das Sittengesetz und mit ihm praktische Vernunft dazu gekommen, und hätte uns diesen Begriff nicht aufgedrungen. Aber auch die Erfahrung bestätigt diese Ordnung der Begriffe in uns. Setzet, dass jemand von seiner wollüstigen Neigung vorgibt, sie sei, wenn ihm der beliebte Gegenstand und die Gelegenheit dazu vorkämen, für ihn ganz unwiderstehlich, ob, wenn ein Galgen vor dem Hause, da er diese Gelegenheit trifft, aufgerichtet wäre, um ihn sogleich nach genossener Wollust daran zu knüpfen, er alsdann nicht seine Neigung bezwingen würde.
Man darf nicht lange raten, was er antworten würde. Fragt ihn aber, ob, wenn sein Fürst ihm, unter Androhung derselben unverzögerten Todesstrafe, zumutete, ein falsches Zeugnis wider einen ehrlichen Mann, den er gerne unter scheinbaren Vorwänden verderben möchte, abzulegen, ob er da, so groß auch seine Liebe zum Leben sein mag, sie wohl zu überwinden für möglich halte. Ob er es tun würde oder nicht, wird er vielleicht sich nicht getrauen zu versichern; dass es ihm aber möglich sei, muss er ohne Bedenken einräumen. Er urteilt also, dass er etwas kann, darum, weil er sich bewusst ist, dass er es soll, und erkennt in sich die Freiheit, die ihm sonst ohne das moralische Gesetz unbekannt geblieben wäre.
Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft
Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
Anmerkung
Die reine Geometrie hat Postulate als praktische Sätze, die aber nichts weiter enthalten, als die Voraussetzung, dass man etwas tun könne, wenn etwa gefordert würde, man solle es tun, und diese sind die einzigen Sätze derselben, die ein Dasein betreffen. Es sind also praktische Regeln unter einer problematischen Bedingung des Willens. Hier aber sagt die Regel, man solle schlechthin auf gewisse Weise verfahren. Die praktische Regel ist also unbedingt, mithin, als kategorisch praktischer Satz, a priori vorgestellt, wodurch der Wille schlechterdings und unmittelbar (durch die praktische Regel selbst, die also hier Gesetz ist) objektiv bestimmt wird. Denn reine, an sich praktische Vernunft ist hier unmittelbar gesetzgebend.
Der Wille wird als unabhängig von empirischen Bedingungen, mithin, als reiner Wille, durch die bloße Form des Gesetzes als bestimmt gedacht, und dieser Bestimmungsgrund als die oberste Bedingung aller Maximen angesehen. Die Sache ist befremdlich genug, und hat ihresgleichen in der ganzen übrigen praktischen Erkenntnis nicht. Denn der Gedanke a priori von einer möglichen allgemeinen Gesetzgebung, der also bloß problematisch ist, wird, ohne von der Erfahrung oder irgendeinem äußeren Willen etwas zu entlehnen, als Gesetz unbedingt geboten. Es ist aber auch nicht eine Vorschrift, nach welcher eine Handlung geschehen soll, dadurch eine begehrte Wirkung möglich ist (denn da wäre die Regel immer physisch bedingt), sondern eine Regel, die bloß den Willen, in Ansehung der Form seiner Maximen, a priori bestimmt, und da ist ein Gesetz, welches bloß zum Behuf der subjektiven Form der Grundsätze dient, als Bestimmungsgrund durch die objektive Form eines Gesetzes überhaupt, wenigstens zu denken, nicht unmöglich. Man kann das Bewusstsein dieses Grundgesetzes ein Faktum der Vernunft nennen, weil man es nicht aus vorhergehenden Datis der Vernunft, z.B. dem Bewusstsein der Freiheit (denn dieses ist uns nicht vorher gegeben), herausvernünfteln kann, sondern weil es sich für sich selbst uns aufdringt als synthetischer Satz a priori, der auf keiner, weder reinen noch empirischen Anschauung gegründet ist, ob er gleich analytisch sein würde, wenn man die Freiheit des Willens voraussetzte, wozu aber, als positivem Begriffe, eine intellektuelle Anschauung erfordert werden würde, die man hier gar nicht annehmen darf. Doch muss man, um dieses Gesetz ohne Missdeutung als gegeben anzusehen, wohl bemerken, dass es kein empirisches, sondern das einzige Faktum der reinen Vernunft sei, die sich dadurch als ursprünglich gesetzgebend (sic volo, sic iubeo) ankündigt.
Folgerung
Reine Vernunft ist für sich allein praktisch, und gibt (dem Menschen) ein allgemeines Gesetz, welches wir das Sittengesetz nennen.
Anmerkung
Das vorher genannte Faktum ist unleugbar. Man darf nur das Urteil zergliedern, welches die Menschen über die Gesetzmäßigkeit ihrer Handlungen fällen, so wird man jederzeit finden, dass, was auch die Neigung dazwischen sprechen mag, ihre Vernunft dennoch, unbestechlich und durch sich selbst gezwungen, die Maxime des Willens bei einer Handlung jederzeit an den reinen Willen halte, d.h. an sich selbst, indem sie sich als a priori praktisch betrachtet. Dieses Prinzip der Sittlichkeit nun, eben um der Allgemeinheit der Gesetzgebung willen, die es zum formalen obersten Bestimmungsgrunde des Willens, unangesehen aller subjektiven Verschiedenheiten desselben, macht, erklärt die Vernunft zugleich zu einem Gesetz für alle vernünftigen Wesen, sofern sie überhaupt einen Willen, d.h. ein Vermögen haben, ihre Kausalität durch die Vorstellung von Regeln zu bestimmen, mithin sofern sie der Handlungen nach Grundsätzen, folglich auch nach praktischen Prinzipien a priori (denn diese haben allein diejenige Notwendigkeit, welche die Vernunft zum Grundsatz fordert), fähig sein. Es schränkt sich also nicht bloß auf Menschen ein, sondern geht auf alle endliche Wesen, die Vernunft und Willen haben, ja schließt sogar das unendliche Wesen, als oberste Intelligenz, mit ein.
Im ersteren Falle aber hat das Gesetz die Form eines Imperativs, weil man an jenem zwar, als vernünftigem Wesen, einen reinen, aber, als mit Bedürfnissen und sinnlichen Bewegursachen affiziertem Wesen, keinen heiligen Willen, d.h. einen solchen, der keiner dem moralischen Gesetze widerstreitenden Maximen fähig wäre, voraussetzen kann. Das moralische Gesetz ist daher bei jenen ein Imperativ, der kategorisch gebietet, weil das Gesetz unbedingt ist; das Verhältnis eines solchen Willens zu diesem Gesetze ist Abhängigkeit, unter dem Namen der Verbindlichkeit, welche eine Nötigung, obzwar durch bloße Vernunft und dessen objektives Gesetz, zu einer Handlung bedeutet, die darum Pflicht heißt, weil eine pathologisch affizierte (obgleich dadurch nicht bestimmte, mithin auch immer freie) Willkür einen Wunsch bei sich führt, der aus subjektiven Ursachen entspringt, daher auch dem reinen objektiven Bestimmungsgrunde oft entgegen sein kann, und also eines Widerstandes der praktischen Vernunft, der ein innerer, aber intellektueller, Zwang genannt werden kann, als moralischer Nötigung bedarf. In der allergenügsamsten Intelligenz wird die Willkür, als keiner Maxime fähig, die nicht zugleich objektiv Gesetz sein konnte, mit Recht vorgestellt, und der Begriff der Heiligkeit, der ihr um deswillen zukommt, setzt sie zwar nicht über alle praktische, aber doch über alle praktisch-einschränkende Gesetze, mithin Verbindlichkeit und Pflicht weg. Diese Heiligkeit des Willens ist gleichwohl eine praktische Idee, welche notwendig zum Urbilde dienen muss, welchem sich ins Unendliche zu nähern das Einzige ist, was allen endlichen vernünftigen Wesen zusteht, und welche das reine Sittengesetz, das darum selbst heilig heißt, ihnen beständig und richtig vor Augen hält, von welchem ins Unendliche gehenden Progressus seiner Maximen und Unwandelbarkeit derselben zum beständigen Fortschreiten sicher zu sein, d.h. Tugend, das Höchste ist, was endliche praktische Vernunft bewirken kann, die selbst wiederum wenigstens als natürlich erworbenes Vermögen nie vollendet sein kann, weil die Sicherheit in solchem Falle niemals apodiktische Gewissheit wird, und als Überredung sehr gefährlich ist.
Lehrsatz IV
Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der ihnen gemäßen Pflichten; alle Heteronomie der Willkür gründet dagegen nicht allein gar keine Verbindlichkeit, sondern ist vielmehr dem Prinzip derselben und der Sittlichkeit des Willens entgegen. In der Unabhängigkeit nämlich von aller Materie des Gesetzes (nämlich einem begehrten Objekte) und zugleich doch Bestimmung der Willkür durch die bloße allgemeine gesetzgebende Form, deren eine Maxime fähig sein muss, besteht das alleinige Prinzip der Sittlichkeit. Jene Unabhängigkeit aber ist Freiheit im negativen, diese eigene Gesetzgebung aber der reinen, und, als solche, praktischen Vernunft ist Freiheit im positiven Verstande. Also drückt das moralische Gesetz nichts anderes aus, als die Autonomie der reinen praktischen Vernunft, d.h. der Freiheit, und diese ist selbst die formale Bedingung aller Maximen, unter der sie allein mit dem obersten praktischen Gesetze zusammenstimmen können. Wenn daher die Materie des Wollens, welche nichts anderes, als das Objekt einer Begierde sein kann, die mit dem Gesetz verbunden wird, in das praktische Gesetz als Bedingung der Möglichkeit desselben hineinkommt, so wird daraus Heteronomie der Willkür, nämlich Abhängigkeit vom Naturgesetze, irgendeinem Antriebe oder Neigung zu folgen, und der Wille gibt sich nicht selbst das Gesetz, sondern nur die Vorschrift zur vernünftigen Befolgung pathologischer Gesetze; die Maxime aber, die auf solche Weise niemals die allgemein-gesetzgebende Form in sich enthalten kann, stiftet auf diese Weise nicht allein keine Verbindlichkeit, sondern ist selbst dem Prinzip einer reinen praktischen Vernunft, hiermit also auch der sittlichen Gesinnung entgegen, wenngleich die Handlung, die daraus entspringt, gesetzmäßig sein sollte.
Anmerkung I
Zum praktischen Gesetze muss also niemals eine praktische Vorschrift gezählt werden, die eine materiale (mithin empirische) Bedingung bei sich führt. Denn das Gesetz des reinen Willens, der frei ist, setzt diesen in eine ganz andere Sphäre, als die empirische, und die Notwendigkeit, die es ausdrückt, da sie keine Naturnotwendigkeit sein soll, kann also bloß in formalen Bedingungen der Möglichkeit eines Gesetzes überhaupt bestehen. Alle Materie praktischer Regeln beruht immer auf subjektiven Bedingungen, die ihr keine Allgemeinheit für vernünftige Wesen, als lediglich die bedingte (im Falle ich dieses oder jenes begehre, was ich alsdann tun müsse, um es wirklich zu machen) verschaffen, und sie drehen sich insgesamt um das Prinzip der eigenen Glückseligkeit.
Nun ist freilich unleugbar, dass alles Wollen auch einen Gegenstand, mithin eine Materie haben müsse; aber diese ist darum nicht eben der Bestimmungsgrund und Bedingung der Maxime; denn, ist sie es, so lässt diese sich nicht in allgemein gesetzgebender Form darstellen, weil die Erwartung der Existenz des Gegenstandes alsdann die bestimmende Ursache der Willkür sein würde, und die Abhängigkeit des Begehrungsvermögens von der Existenz irgendeiner Sache dem Wollen zum Grunde gelegt werden müsste, welche immer nur in empirischen Bedingungen gesucht werden, und daher niemals den Grund zu einer notwendigen und allgemeinen Regel abgeben kann. So wird fremder Wesen Glückseligkeit das Objekt des Willens eines vernünftigen Wesens sein können. Wäre sie aber der Bestimmungsgrund der Maxime, so müsste man voraussetzen, dass wir in dem Wohlsein anderer nicht allein ein natürliches Vergnügen, sondern auch ein Bedürfnis finden, so wie die sympathetische Sinnesart bei Menschen es mit sich bringt. Aber dieses Bedürfnis kann ich nicht bei jedem vernünftigen Wesen (bei Gott gar nicht) voraussetzen.
Also kann zwar die Materie der Maxime bleiben, sie muss aber nicht die Bedingung derselben sein, denn sonst würde diese nicht zum Gesetze taugen. Also die bloße Form eines Gesetzes, welches die Materie einschränkt, muss zugleich ein Grund sein, diese Materie zum Willen hinzuzufügen, aber sie nicht vorauszusetzen. Die Materie sei z.B. meine eigene Glückseligkeit. Diese, wenn ich sie jedem beilege (wie ich es denn in der Tat bei endlichen Wesen tun darf), kann nur alsdann ein objektives praktisches Gesetz werden, wenn ich anderer ihre in dieselbe mit einschließe. Also entspringt das Gesetz, anderer Glückseligkeit zu befördern, nicht von der Voraussetzung, dass dieses ein Objekt für jedes seine Willkür sei, sondern bloß daraus, dass die Form der Allgemeinheit, die der Vernunft als Bedingung bedarf, einer Maxime der Selbstliebe die objektive Gültigkeit eines Gesetzes zu geben, der Bestimmungsgrund des Willens wird, und also war das Objekt (anderer Glückseligkeit) nicht der Bestimmungsgrund des reinen Willens, sondern die bloße gesetzliche Form war es allein, dadurch ich meine auf Neigung gegründete Maxime einschränkte, um ihr die Allgemeinheit eines Gesetzes zu verschaffen, und sie so der reinen praktischen Vernunft angemessen zu machen, aus welcher Einschränkung, und nicht dem Zusatz einer äußeren Triebfeder, alsdann der Begriff der Verbindlichkeit, die Maxime meiner Selbstliebe auch auf die Glückseligkeit anderer zu erweitern, allein entspringen könnte.
Anmerkung II
Das gerade Widerspiel des Prinzips der Sittlichkeit ist, wenn das der eigenen Glückseligkeit zum Bestimmungsgrunde des Willens gemacht wird, wozu, wie ich oben gezeigt habe, alles überhaupt gezählt werden muss, was den Bestimmungsgrund, der zum Gesetze dienen soll, irgendworan anders, als in der gesetzgebenden Form der Maxime setzt. Dieser Widerstreit ist aber nicht bloß logisch, wie der zwischen empirisch-bedingten Regeln, die man doch zu notwendigen Erkenntnisprinzipien erheben wollte, sondern praktisch, und würde, wäre nicht die Stimme der Vernunft in Beziehung auf den Willen so deutlich, so unüberschreibar, selbst für den gemeinsten Menschen so vernehmlich, die Sittlichkeit gänzlich zu Grunde richten; so aber kann sie sich nur noch in den kopfverwirrenden Spekulationen der Schulen erhalten, die dreist genug sein, sich gegen jene himmlische Stimme taub zu machen, um eine Theorie, die kein Kopfzerbrechen kostet, aufrecht zu erhalten.
Wenn ein dir sonst beliebter Umgangsfreund sich bei dir wegen eines falschen abgelegten Zeugnisses dadurch zu rechtfertigen vermeinte, dass er zuerst die, seinem Vorgeben nach, heilige Pflicht der eigenen Glückseligkeit vorschützte, alsdann die Vorteile herzählte, die er sich alle dadurch erworben, die Klugheit namhaft machte, die er beobachtet, um wider aller Entdeckung sicher zu sein, selbst wider der von Seiten deiner selbst, dem er das Geheimnis darum allein offenbart, damit er es zu aller Zeit ableugnen könne; dann aber im ganzen Ernst vorgäbe, er habe eine wahre Menschenpflicht ausgeübt, so würdest du ihm entweder gerade ins Gesicht lachen, oder mit Abscheu davon zurückbeben, obgleich du, wenn jemand bloß auf eigene Vorteile seine Grundsätze gesteuert hat, wider diese Maßregeln nicht das mindeste einzuwenden hättest. Oder setzet, es empfehle euch jemand einen Mann zum Haushalter, dem ihr alle eure Angelegenheiten blindlings anvertrauen könnte, und, um euch Zutrauen einzuflößen, rühmte er ihn als einen klugen Menschen, der sich auf seinen eigenen Vorteil meisterhaft verstehe, auch als einen rastlos wirksamen, der keine Gelegenheit dazu ungenutzt vorbeigehen ließe, endlich, damit auch ja nicht Besorgnisse wegen eines pöbelhaften Eigennutzes desselben im Wege stünden, rühmte er, wie er recht fein zu leben verstünde, nicht im Geldsammeln oder brutaler Üppigkeit, sondern in der Erweiterung seiner Kenntnisse, einem wohl gewählten belehrenden Umgange, selbst im Wohltun der Dürftigen, sein Vergnügen suchte, übrigens aber wegen der Mittel (die doch ihren Wert oder Unwert nur vom Zweck entlehnen) nicht bedenklich wäre, und fremdes Geld und Gut ihm hierzu, sobald er nur wisse, dass er es unentdeckt und ungehindert tun könne, so gut wie sein eigenes wäre, so würdet ihr entweder glauben, der Empfehlende habe euch zum Besten, oder er habe den Verstand verloren. So deutlich und scharf sind die Grenzen der Sittlichkeit und der Selbstliebe abgeschnitten, dass selbst das gemeinste Auge den Unterschied, ob etwas zu der einen oder der andern gehöre, gar nicht verfehlen kann. Folgende wenige Bemerkungen können zwar bei einer so offenbaren Wahrheit überflüssig scheinen, allein sie dienen doch wenigstens dazu, dem Urteile der gemeinen Menschenvernunft etwas mehr Deutlichkeit zu verschaffen.
Das Prinzip der Glückseligkeit kann zwar Maximen, aber niemals solche abgeben, die zu Gesetzen des Willens tauglich wären, selbst wenn man sich die allgemeine Glückseligkeit zum Objekte machte. Denn, weil dieser ihre Erkenntnis auf lauter Erfahrungsdatis beruht, weil jedes Urteil darüber gar sehr von jedes seiner Meinung, die noch dazu selbst sehr veränderlich ist, abhängt, so kann es wohl generelle, aber niemals universelle Regeln, d.h. solche, die im Durchschnitte am öftesten zutreffen, nicht aber solche, die jederzeit und notwendig gültig sein müssen, geben, mithin können keine praktischen Gesetze darauf gegründet werden. Eben darum, weil hier ein Objekt der Willkür der Regel derselben zum Grunde gelegt und also vor dieser vorhergehen muss, so kann diese nicht worauf anders, als auf das, was man empfiehlt, und also auf Erfahrung bezogen und darauf gegründet werden, und da muss die Verschiedenheit des Urteils endlos sein. Dieses Prinzip schreibt also nicht allen vernünftigen Wesen eben dieselbe praktische Regel vor, ob sie zwar unter einem gemeinsamen Titel, nämlich dem der Glückseligkeit, stehen. Das moralische Gesetz wird aber nur darum als objektiv notwendig gedacht, weil es für jedermann gelten soll, der Vernunft und Willen hat.
Die Maxime der Selbstliebe (Klugheit) rät bloß an; was das Gesetz der Sittlichkeit gebietet. Es ist aber doch ein großer Unterschied zwischen dem, wozu man uns anrätig ist, und dem, wozu wir verbindlich sind. Was nach dem Prinzip der Autonomie der Willkür zu tun sei, ist für den gemeinsten Verstand ganz leicht und ohne Bedenken einzusehen; was unter Voraussetzung der Heteronomie derselben zu tun sei, schwer, und erfordert Weltkenntnis; d.h. was Pflicht sei, bietet sich jedermann von selbst dar; was aber wahren dauerhaften Vorteil bringe, ist allemal, wenn dieser auf das ganze Dasein erstreckt werden soll, in undurchdringliches Dunkel eingehüllt, und erfordert viel Klugheit, um die praktische darauf gestimmte Regel durch geschickte Ausnahmen auch nur auf erträgliche Art den Zwecken des Lebens anzupassen. Gleichwohl gebietet das sittliche Gesetz jedermann, und zwar die pünktlichste, Befolgung. Es muss also zu der Beurteilung dessen, was nach ihm zu tun sei, nicht so schwer sein, dass nicht der gemeinste und ungeübteste Verstand selbst ohne Weltklugheit damit umzugehen wüsste.
Dem kategorischen Gebote der Sittlichkeit Genüge zu leisten, ist in jedes Gewalt zu aller Zeit, der empirisch-bedingten Vorschrift der Glückseligkeit nur selten, und bei weitem nicht, auch nur in Ansehung einer einzigen Absicht, für jedermann möglich. Die Ursache ist, weil es bei dem ersteren nur auf die Maxime ankommt, die echt und rein sein muss, bei der letzteren aber auch auf die Kräfte und das physische Vermögen, einen begehrten Gegenstand wirklich zu machen. Ein Gebot, dass jedermann sich glücklich zu machen suchen sollte, wäre töricht; denn man gebietet niemals jemanden das, was er schon unausbleiblich von selbst will. Man müsste ihm bloß die Maßregeln gebieten, oder vielmehr darreichen, weil er nicht alles das kann, was er will. Sittlichkeit aber gebieten, unter dem Namen der Pflicht, ist ganz vernünftig; denn deren Vorschrift will erstlich eben nicht jedermann gerne gehorchen, wenn sie mit Neigungen im Widerstreite ist, und was die Maßregeln betrifft, wie er dieses Gesetz befolgen könne, so dürfen diese hier nicht gelehrt werden; denn, was er in dieser Beziehung will, das kann er auch.
Der im Spiel verloren hat, kann sich wohl über sich selbst und seine Unklugheit ärgern, aber wenn er sich bewusst ist, im Spiel betrogen (obzwar dadurch gewonnen) zu haben, so muss er sich selbst verachten, sobald er sich mit dem sittlichen Gesetze vergleicht. Dieses muss also doch wohl etwas anderes, als das Prinzip der eigenen Glückseligkeit sein. Denn zu sich selber sagen zu müssen: ich bin ein Nichtswürdiger, ob ich gleich meinen Beutel gefüllt habe, muss doch ein anderes Richtmaß des Urteils haben, als sich selbst Beifall zu geben, und zu sagen: ich bin ein kluger Mensch, denn ich habe meine Kasse bereichert.
Endlich ist noch etwas in der Idee unserer praktischen Vernunft, welches die Übertretung eines sittlichen Gesetzes begleitet, nämlich ihre Strafwürdigkeit. Nun lässt sich mit dem Begriffe einer Strafe, als einer solchen, doch gar nicht das Teilhaftigwerden der Glückseligkeit verbinden. Denn obgleich der, so da straft, wohl zugleich die gütige Absicht haben kann, diese Strafe auch auf diesen Zweck zu richten, so muss sie doch zuvor als Strafe, d.h. als bloßes Übel für sich selbst gerechtfertigt sein, so dass der Gestrafte, wenn es dabei bliebe, und er auch auf keine sich hinter dieser Härte verbergende Gunst hinaussähe, selbst gestehen muss, es sei ihm recht geschehen, und sein Los sei seinem Verhalten vollkommen angemessen. In jeder Strafe, als solcher, muss zuerst Gerechtigkeit sein, und diese macht das Wesentliche dieses Begriffs aus. Mit ihr kann zwar auch Gütigkeit verbunden werden, aber auf diese hat der Strafwürdige, nach seiner Aufführung, nicht die mindeste Ursache sich Rechnung zu machen. Also ist Strafe ein physisches Übel, welches, wenn es auch nicht als natürliche Folge mit dem moralisch Bösen verbunden wäre, doch als Folge nach Prinzipien einer sittlichen Gesetzgebung verbunden werden müsste.
Wenn nun alles Verbrechen, auch ohne auf die physischen Folgen in Ansehung des Täters zu sehen, für sich strafbar ist, d.h. Glückseligkeit (wenigstens zum Teil) verwirkt, so wäre es offenbar ungereimt zu sagen: das Verbrechen habe darin eben bestanden, dass er sich eine Strafe zugezogen hat, indem er seiner eigenen Glückseligkeit Abbruch tat (welches nach dem Prinzip der Selbstliebe der eigentliche Begriff allen Verbrechens sein müsste). Die Strafe würde auf diese Art der Grund sein, etwas ein Verbrechen zu nennen, und die Gerechtigkeit müsste vielmehr darin bestehen, alle Bestrafung zu unterlassen und selbst die natürliche zu verhindern; denn alsdann wäre in der Handlung nichts Böses mehr, weil die Übel, die sonst darauf folgten, und um deren willen die Handlung allein böse hieß, nunmehr abgehalten wären. Vollends aber alles Strafen und Belohnen nur als das Maschinenwerk in der Hand einer höheren Macht anzusehen, welches vernünftige Wesen dadurch zu ihrer Endabsicht (der Glückseligkeit) in Tätigkeit zu setzen allein dienen sollte, ist gar zu sichtbar ein alle Freiheit aufhebender Mechanismus ihres Willens, als dass es nötig wäre, uns hierbei aufzuhalten.
Feiner noch, obgleich ebenso unwahr, ist das Vorgeben derer, die einen gewissen moralischen besonderen Sinn annehmen, der, und nicht die Vernunft, das moralische Gesetz bestimmte, nach welchem das Bewusstsein der Tugend unmittelbar mit Zufriedenheit und Vergnügen, das des Lasters aber mit Seelenunruhe und Schmerz verbunden wäre, und so alles doch auf Verlangen nach eigener Glückseligkeit aussetzen. Ohne das hierher zu ziehen, was oben gesagt worden ist, will ich nur die Täuschung bemerken, die hierbei vorgeht. Um den Lasterhaften als durch das Bewusstsein seiner Vergehungen mit Gemütsunruhe geplagt vorzustellen, müssen sie ihn, der vornehmsten Grundlage seines Charakters nach, schon zum Voraus als, wenigstens in einigem Grade, moralisch gut, so wie den, welchen das Bewusstsein pflichtmäßiger Handlungen ergötzt, vorher schon als tugendhaft vorstellen. Also musste doch der Begriff der Moralität und Pflicht vor aller Rücksicht auf diese Zufriedenheit vorhergehen und kann von dieser gar nicht abgeleitet werden. Nun muss man doch die Wichtigkeit dessen, was wir Pflicht nennen, das Ansehen des moralischen Gesetzes und den unmittelbaren Wert, den die Befolgung desselben der Person in ihren eigenen Augen gibt, vorher schätzen, um jene Zufriedenheit in dem Bewusstsein seiner Angemessenheit zu derselben und den bitteren Verweis, wenn man sich dessen Übertretung vorwerfen kann, zu fühlen. Man kann also diese Zufriedenheit oder Seelenunruhe nicht vor der Erkenntnis der Verbindlichkeit fühlen und sie zum Grunde der letzteren machen. Man muss wenigstens auf dem halben Wege schon ein ehrlicher Mann sein, um sich von jenen Empfindungen auch nur eine Vorstellung machen zu können. Dass übrigens, so wie, vermöge der Freiheit, der menschliche Wille durchs moralische Gesetz unmittelbar bestimmbar ist, auch die öftere Ausübung, diesem Bestimmungsgrunde gemäß, subjektiv zuletzt ein Gefühl der Zufriedenheit mit sich selbst wirken könne, bin ich gar nicht in Abrede; vielmehr gehört es selbst zur Pflicht, dieses, welches eigentlich allein das moralische Gefühl genannt zu werden verdient, zu gründen und zu kultivieren; aber der Begriff der Pflicht kann davon nicht abgeleitet werden, sonst müssten wir uns ein Gefühl eines Gesetzes als eines solchen denken, und das zum Gegenstand der Empfindung machen, was nur durch Vernunft gedacht werden kann; welches, wenn es nicht ein platter Widerspruch werden soll, allen Begriff der Pflicht ganz aufheben, und an deren statt bloß ein mechanisches Spiel feinerer, mit den gröberen bisweilen in Zwist geratender, Neigungen setzen würde.
Wenn wir nun unseren formalen obersten Grundsatz der reinen praktischen Vernunft (als einer Autonomie des Willens) mit allen bisherigen materialen Prinzipien der Sittlichkeit vergleichen, so können wir in einer Tafel alle übrigen, als solche, dadurch wirklich zugleich alle möglichen anderen Fälle, außer einem einzigen formalen, erschöpft sind, vorstellig machen, und so durch den Augenschein beweisen, dass es vergeblich sei, sich nach einem andern Prinzip, als dem jetzt vorgetragenen, umzusehen. Alle möglichen Bestimmungsgründe des Willens sind nämlich entweder bloß subjektiv und also empirisch, oder auch objektiv und rational; beide aber entweder äußere oder innere.
Die auf der linken Seite stehenden sind insgesamt empirisch und taugen offenbar gar nicht zum allgemeinen Prinzip der Sittlichkeit. Aber die auf der rechten Seite gründen sich auf der Vernunft (denn Vollkommenheit, als Beschaffenheit der Dinge, und die höchste Vollkommenheit, in Substanz vorgestellt, d.h. Gott, sind beide nur durch Vernunftbegriffe zu denken). Allein der erstere Begriff, nämlich der Vollkommenheit, kann entweder in theoretischer Bedeutung genommen werden, und da bedeutet er nichts, als Vollständigkeit eines jeden Dinges in seiner Art (transzendentale), oder eines Dinges bloß als Dinges überhaupt (metaphysische), und davon kann hier nicht die Rede sein. Der Begriff der Vollkommenheit in praktischer Bedeutung aber ist die Tauglichkeit, oder Zulänglichkeit eines Dinges zu allerlei Zwecken. Diese Vollkommenheit, als Beschaffenheit des Menschen, folglich innerliche, ist nichts anderes als Talent, und, was dieses stärkt oder ergänzt, Geschicklichkeit. Die höchste Vollkommenheit in Substanz, d.h. Gott, folglich äußerliche (in praktischer Absicht betrachtet), ist die Zulänglichkeit dieses Wesens zu allen Zwecken überhaupt. Wenn nun also uns Zwecke vorher gegeben werden müssen, in Beziehung auf welche der Begriff der Vollkommenheit (einer inneren, an uns selbst, oder einer äußeren, an Gott) allein Bestimmungsgrund des Willens werden kann, ein Zweck aber, als Objekt, welches vor der Willensbestimmung durch eine praktische Regel vorhergehen und den Grund der Möglichkeit einer solchen enthalten muss, mithin die Materie des Willens, als Bestimmungsgrund desselben genommen, jederzeit empirisch ist, mithin zum epikurischen Prinzip der Glückseligkeitslehre, niemals aber zum reinen Vernunftprinzip der Sittenlehre und der Pflicht dienen kann (wie denn Talent und ihre Beförderung nur, weil sie zu Vorteilen des Lebens beitragen, oder der Wille Gottes, wenn Einstimmung mit ihm, ohne vorhergehendes von dessen Idee unabhängiges praktisches Prinzip, zum Objekt des Willens genommen wurden, nur durch die Glückseligkeit, die wir davon erwarten, Bewegursache desselben werden können), so folgt erstlich, dass alle hier aufgestellte Prinzipien material sind, zweitens, dass sie alle mögliche materiale Prinzipien befassen, und daraus endlich der Schluss, dass, weil materiale Prinzipien zum obersten Sittengesetz ganz untauglich sind (wie bewiesen worden ist), das formale praktische Prinzip der reinen Vernunft, nach welchem die bloße Form einer durch unsere Maximen möglichen allgemeinen Gesetzgebung den obersten und unmittelbaren Bestimmungsgrund des Willens ausmachen muss, das einzige Mögliche sei, welches zu kategorischen Imperativen, d.h. praktischen Gesetzen (welche Handlungen zur Pflicht machen), und überhaupt zum Prinzip der Sittlichkeit, sowohl in der Beurteilung, als auch der Anwendung auf den menschlichen Willen, in Bestimmung desselben, tauglich ist.
Von der Deduktion der Grundsätze der reinen praktischen Vernunft
Diese Analytik tut dar, dass reine Vernunft praktisch sein, d.h. für sich, unabhängig von allem Empirischen, den Willen bestimmen könne und dieses zwar durch ein Faktum, worin sich reine Vernunft bei uns in der Tat praktisch beweist), nämlich die Autonomie in dem Grundsatze der Sittlichkeit, wodurch sie den Willen zur Tat bestimmt. Sie zeigt zugleich, dass dieses Faktum mit dem Bewusstsein der Freiheit des Willens unzertrennlich verbunden, ja mit ihm einerlei sei, wodurch der Wille eines vernünftigen Wesens, das, als zur Sinnenwelt gehörig, sich, gleich anderen wirksamen Ursachen, notwendig den Gesetzen der Kausalität unterworfen erkennt, im Praktischen doch zugleich sich auf einer andern Seite, nämlich als Wesen an sich selbst, seines in einer intelligibelen Ordnung der Dinge bestimmbaren Daseins bewusst ist, zwar nicht einer besonderen Anschauung seiner selbst, sondern gewissen dynamischen Gesetzen gemäß, die die Kausalität desselben in der Sinnenwelt bestimmen können; denn, dass Freiheit, wenn sie uns beigelegt wird, uns in eine intelligibele Ordnung der Dinge versetzt, ist anderwärts hinreichend bewiesen worden.
Wenn wir nun damit den analytischen Teil der Kritik der reinen spekulativen Vernunft vergleichen, so zeigt sich ein merkwürdiger Kontrast beider gegeneinander Nicht Grundsätze, sondern reine sinnliche Anschauung (Raum und Zeit) war daselbst das erste Datum, welches Erkenntnis a priori und zwar nur für Gegenstände der Sinne möglich machte. Synthetische Grundsätze aus bloßen Begriffen ohne Anschauung waren unmöglich, vielmehr konnten diese nur in Beziehung auf jene, welche sinnlich war, mithin auch nur auf Gegenstände möglicher Erfahrung stattfinden, weil die Begriffe des Verstandes, mit dieser Anschauung verbunden, allein dasjenige Erkenntnis möglich machen, welches wir Erfahrung nennen. Über die Erfahrungsgegenstände hinaus, also von Dingen als Noumenon wurde der spekulativen Vernunft alles Positive einer Erkenntnis mit völligem Rechte abgesprochen. Doch leistete diese so viel, dass sie den Begriff des Noumenon, d.h. die Möglichkeit, ja Notwendigkeit, dergleichen zu denken, in Sicherheit setzte, und z.B. die Freiheit, negativ betrachtet, anzunehmen, als ganz verträglich mit jenen Grundsätzen und Einschränkungen der reinen theoretischen Vernunft, wider alle Einwürfe rettete, ohne doch von solchen Gegenständen irgendetwas Bestimmtes und Erweiterndes zu erkennen zu geben, indem sie vielmehr alle Aussicht dahin gänzlich abschnitt.
Dagegen gibt das moralische Gesetz, wenngleich keine Aussicht, dennoch ein schlechterdings aus allen Datis der Sinnenwelt und dem ganzen Umfang unseres theoretischen Vernunftgebrauchs unerklärliches Faktum an die Hand, das auf eine reine Verstandeswelt Anzeige gibt, ja diese sogar positiv bestimmt und uns etwas von ihr, nämlich ein Gesetz, erkennen lässt.
Dieses Gesetz soll der Sinnenwelt, als einer sinnlichen Natur (was die vernünftigen Wesen betrifft), die Form einer Verstandeswelt, d.h. einer übersinnlichen Natur verschaffen, ohne doch jener ihrem Mechanismus Abbruch zu tun. Nun ist Natur im allgemeinsten Verstande die Existenz der Dinge unter Gesetzen. Die sinnliche Natur vernünftiger Wesen überhaupt ist die Existenz derselben unter empirisch bedingten Gesetzen, mithin für die Vernunft Heteronomie. Die übersinnliche Natur eben derselben Wesen ist dagegen ihre Existenz nach Gesetzen, die von aller empirischen Bedingung unabhängig sind, mithin zur Autonomie der reinen Vernunft gehören. Und, da die Gesetze, nach welchen das Dasein der Dinge vom Erkenntnis abhängt, praktisch sind, so ist die übersinnliche Natur, soweit wir uns einen Begriff von ihr machen können, nichts anderes, als eine Natur unter der Autonomie der reinen praktischen Vernunft. Das Gesetz dieser Autonomie aber ist das moralische Gesetz; welches also das Grundgesetz einer übersinnlichen Natur und einer reinen Verstandeswelt ist, deren Gegenbild in der Sinnenwelt, aber doch zugleich ohne Abbruch der Gesetze derselben, existieren soll. Man könnte jene die urbildliche (natura archetypa), die wir bloß in der Vernunft erkennen, diese aber, weil sie die mögliche Wirkung der Idee der ersteren, als Bestimmungsgrund des Willens, enthält, die nachgebildete (natura ectypa) nennen. Denn in der Tat versetzt uns das moralische Gesetz der Idee nach in eine Natur, in welcher reine Vernunft, wenn sie mit dem ihr angemessenen physischen Vermögen begleitet wäre, das höchste Gut hervorbringen würde, und bestimmt unseren Willen, die Form der Sinnenwelt, als einem Ganzen vernünftiger Wesen, zu erteilen.
Dass diese Idee wirklich unseren Willensbestimmungen gleichsam als Vorzeichnung zum Muster liege, bestätigt die gemeinste Aufmerksamkeit auf sich selbst. Wenn die Maxime, nach der ich ein Zeugnis abzulegen gesonnen bin, durch die praktische Vernunft geprüft wird, so sehe ich immer danach, wie sie sein würde, wenn sie als allgemeines Naturgesetz gelte. Es ist offenbar, in dieser Art würde es jedermann zur Wahrhaftigkeit nötigen. Denn es kann nicht mit der Allgemeinheit eines Naturgesetzes bestehen, Aussagen für beweisend und dennoch als vorsätzlich unwahr gelten zu lassen. Ebenso wird die Maxime, die ich in Ansehung der freien Disposition über mein Leben nehme, sofort bestimmt, wenn ich mich frage, wie sie sein müsste, damit sich eine Natur nach einem Gesetze derselben erhalte. Offenbar würde niemand in einer solchen Natur sein Leben willkürlich endigen können, denn eine solche Verfassung würde keine bleibende Naturordnung sein, und so in allen übrigen Fällen. Nun ist aber in der wirklichen Natur, so wie sie ein Gegenstand der Erfahrung ist, der freie Wille nicht von selbst zu solchen Maximen bestimmt, die für sich selbst eine Natur nach allgemeinen Gesetzen gründen könnten, oder auch in eine solche, die nach ihnen angeordnet wäre, von selbst passten, vielmehr sind es Privatneigungen, die zwar ein Naturganzes nach pathologischen (physischen) Gesetzen, aber nicht eine Natur, die allein durch unsern Willen nach reinen praktischen Gesetzen möglich wäre, ausmachen. Gleichwohl sind wir uns durch die Vernunft eines Gesetzes bewusst, welchem, als ob durch unseren Willen zugleich eine Naturordnung entspringen müsste, alle unsere Maximen unterworfen sind. Also muss dieses die Idee einer nicht empirisch-gegebenen und dennoch durch Freiheit möglichen, mithin übersinnlichen Natur sein, der wir, wenigstens in praktischer Beziehung, objektive Realität geben, weil wir sie als Objekt unseres Willens, als reiner vernünftiger Wesen ansehen.
Der Unterschied also zwischen den Gesetzen einer Natur, welcher der Wille unterworfen ist, und einer Natur, die einem Willen (in Ansehung dessen, was Beziehung desselben auf seine freie Handlungen hat) unterworfen ist, beruht darauf, dass bei jener die Objekte Ursachen der Vorstellungen sein müssen, die den Willen bestimmen, bei dieser aber der Wille Ursache von den Objekten sein soll, so dass die Kausalität desselben ihren Bestimmungsgrund lediglich in reinem Vernunftvermögen liegen hat, welches deshalb auch eine reine praktische Vernunft genannt werden kann.
Die zwei Aufgaben also, wie reine Vernunft einerseits a priori Objekte erkennen, und wie sie andererseits unmittelbar ein Bestimmungsgrund des Willens, d.h. der Kausalität des vernünftigen Wesens in Ansehung der Wirklichkeit der Objekte (bloß durch den Gedanken der Allgemeingültigkeit ihrer eigenen Maximen als Gesetzes), sein könne, sind sehr verschieden.
Die erste, als zur Kritik der reinen spekulativen Vernunft gehörig, erfordert, dass zuvor erklärt werde, wie Anschauungen, ohne welche uns überall kein Objekt gegeben und also auch keines synthetisch erkannt werden kann, a priori möglich sind, und ihre Auflösung fällt dahin aus, dass sie insgesamt nur sinnlich sein, daher auch keine spekulative Erkenntnis möglich werden lassen, das weiterginge, als mögliche Erfahrung reicht, und dass daher alle Grundsätze jener reinen praktischen Vernunft nichts weiter ausrichten, als Erfahrung, entweder von gegebenen Gegenständen, oder denen, die ins Unendliche gegeben werden mögen, niemals aber vollständig gegeben sind, möglich zu machen.
Die zweite, als zur Kritik der praktischen Vernunft gehörig, fordert keine Erklärung, wie die Objekte des Begehrungsvermögens möglich sind, denn das bleibt, als Aufgabe der theoretischen Naturkenntnis, der Kritik der spekulativen Vernunft überlassen, sondern nur, wie Vernunft die Maxime des Willens bestimmen könne, ob es nur vermittelst empirischer Vorstellung, als Bestimmungsgründe, geschehe, oder ob auch reine Vernunft praktisch und ein Gesetz einer möglichen, gar nicht empirisch erkennbaren, Naturordnung sein würde. Die Möglichkeit einer solchen übersinnlichen Natur, deren Begriff zugleich der Grund der Wirklichkeit derselben durch unseren freien Willen sein könne, bedarf keiner Anschauung a priori (einer intelligibelen Welt), die in diesem Falle, als übersinnlich, für uns auch unmöglich sein müßte. Denn es kommt nur auf den Bestimmungsgrund des Wollens in den Maximen desselben an, ob jener empirisch, oder ein Begriff der reinen Vernunft (von der Gesetzmäßigkeit derselben überhaupt) sei, und wie er letzteres sein könne.
Ob die Kausalität des Willens zur Wirklichkeit der Objekte zulange oder nicht, bleibt den theoretischen Prinzipien der Vernunft zu beurteilen überlassen, als Untersuchung der Möglichkeit der Objekte des Wollens, deren Anschauung also in der praktischen Aufgabe gar kein Moment derselben ausmacht. Nur auf die Willensbestimmung und den Bestimmungsgrund der Maxime desselben, als eines freien Willens, kommt es hier an, nicht auf den Erfolg. Denn, wenn der Wille nur für die reine Vernunft gesetzmäßig ist, so mag es mit dem Vermögen desselben in der Ausführung stehen, wie es wolle, es mag nach diesen Maximen der Gesetzgebung einer möglichen Natur eine solche wirklich daraus entspringen oder nicht, darum bekümmert sich die Kritik, die da untersucht, ob und wie reine Vernunft praktisch, d.h. unmittelbar willenbestimmend, sein könne, gar nicht.
In diesem Geschäft kann sie also ohne Tadel und muss sie von reinen praktischen Gesetzen und deren Wirklichkeit anfangen. Statt der Anschauung aber legt sie denselben den Begriff ihres Daseins in der intelligibelen Welt, nämlich der Freiheit, zu Grunde. Denn dieser bedeutet nichts anders, und jene Gesetze sind nur in Beziehung auf Freiheit des Willens möglich, unter Voraussetzung derselben aber notwendig, oder, umgekehrt, diese ist notwendig, weil jene Gesetze, als praktische Postulate, notwendig sind. Wie nun dieses Bewusstsein der moralischen Gesetze, oder, welches einerlei ist, das der Freiheit, möglich sei, lässt sich nicht weiter erklären, nur die Zulässigkeit derselben in der theoretischen Kritik gar wohl verteidigen.
Die Exposition des obersten Grundsatzes der praktischen Vernunft ist nun geschehen, d.h. erstlich, was er enthalte, dass er gänzlich a priori und unabhängig von empirischen Prinzipien für sich bestehe, und dann, worin er sich von allen anderen praktischen Grundsätzen unterscheide, gezeigt worden. Mit der Deduktion, d.h. der Rechtfertigung seiner objektiven und allgemeinen Gültigkeit und der Einsicht der Möglichkeit eines solchen synthetischen Satzes a priori, darf man nicht so gut fortzukommen hoffen, als es mit den Grundsätzen des reinen theoretischen Verstandes anging. Denn diese bezogen sich auf Gegenstände möglicher Erfahrung, nämlich auf Erscheinungen, und man konnte beweisen, dass nur dadurch, dass diese Erscheinungen nach Maßgabe jener Gesetze unter die Kategorien gebracht werden, diese Erscheinungen als Gegenstände der Erfahrung erkannt werden können, folglich alle mögliche Erfahrung diesen Gesetzen angemessen sein müsse. Einen solchen Gang kann ich aber mit der Deduktion des moralischen Gesetzes nicht nehmen. Denn es betrifft nicht die Erkenntnis von der Beschaffenheit der Gegenstände, die der Vernunft irgend wodurch anderwärts gegeben werden mögen, sondern eine Erkenntnis, sofern es der Grund von der Existenz der Gegenstände selbst werden kann und die Vernunft durch dieselbe Kausalität in einem vernünftigen Wesen hat, d.h. reine Vernunft, die als ein unmittelbar den Willen bestimmendes Vermögen angesehen werden kann.
Nun ist aber alle menschliche Einsicht zu Ende, sobald wir zu Grundkräften oder Grundvermögen gelangt sind; denn deren Möglichkeit kann durch nichts begriffen, darf aber auch ebenso wenig beliebig erdichtet und angenommen werden. Daher kann uns im theoretischen Gebrauch der Vernunft nur Erfahrung dazu berechtigen, sie anzunehmen. Dieses Surrogat, statt einer Deduktion, aus Erkenntnisquellen a priori, empirische Beweise anzuführen, ist uns hier aber in Ansehung des reinen praktischen Vernunftvermögens auch genommen. Denn, was den Beweisgrund seiner Wirklichkeit von der Erfahrung herzuholen bedarf, muss den Gründen seiner Möglichkeit nach von Erfahrungsprinzipien abhängig sein, für dergleichen aber reine und doch praktische Vernunft schon ihres Begriffs wegen unmöglich gehalten werden kann. Auch ist das moralische Gesetz gleichsam als ein Faktum der reinen Vernunft, dessen wir uns a priori bewusst sind und welches apodiktisch gewiss ist, gegeben, gesetzt, dass man auch in der Erfahrung kein Beispiel, da es genau befolgt wäre, auftreiben konnte. Also kann die objektive Realität des moralischen Gesetzes durch keine Deduktion, durch alle Anstrengung der theoretischen, spekulativen oder empirisch unterstützten Vernunft, bewiesen, und also, wenn man auch auf die apodiktische Gewissheit Verzicht tun wollte, durch Erfahrung bestätigt und so a posteriori bewiesen werden, und steht dennoch für sich selbst fest.
Etwas anderes aber und ganz Widersinniges tritt an die Stelle dieser vergeblich gesuchten Deduktion des moralischen Prinzips, nämlich, dass es umgekehrt selbst zum Prinzip der Deduktion eines unerforschlichen Vermögens dient, welches keine Erfahrung beweisen, die spekulative Vernunft aber (um unter ihren kosmologischen Ideen das Unbedingte seiner Kausalität nach zu finden, damit sie sich selbst nicht widerspreche) wenigstens als möglich annehmen musste, nämlich das der Freiheit, von der das moralische Gesetz, welches selbst keiner rechtfertigenden Gründe bedarf, nicht bloß die Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit an Wesen beweist, die dies Gesetz als für sie verbindend erkennen.
Das moralische Gesetz ist in der Tat ein Gesetz der Kausalität durch Freiheit, und also der Möglichkeit einer übersinnlichen Natur, so wie das metaphysische Gesetz der Begebenheiten in der Sinnenwelt ein Gesetz der Kausalität der sinnlichen Natur war, und jenes bestimmt also das, was spekulative Philosophie unbestimmt lassen musste, nämlich das Gesetz für eine Kausalität, deren Begriff in der letzteren nur negativ war, und verschafft diesem also zuerst objektive Realität. Diese Art von Kreditiv des moralischen Gesetzes, da es selbst als ein Prinzip der Deduktion der Freiheit, als einer Kausalität der reinen Vernunft, aufgestellt wird, ist, da die theoretische Vernunft wenigstens die Möglichkeit einer Freiheit anzunehmen genötigt war, zur Ergänzung eines Bedürfnisses derselben, statt aller Rechtfertigung a priori völlig hinreichend. Denn das moralische Gesetz beweist seine Realität dadurch auch für die Kritik der spekulativen Vernunft genugtuend, dass es einer bloß negativ gedachten Kausalität, deren Möglichkeit jener unbegreiflich und dennoch sie anzunehmen nötig war, positive Bestimmung, nämlich den Begriff einer den Willen unmittelbar (durch die Bedingung einer allgemeinen gesetzlichen Form seiner Maximen) bestimmenden Vernunft hinzufügt, und so der Vernunft, die mit ihren Ideen, wenn sie spekulativ verfahren wollte, immer überschwenglich wurde, zum ersten Male objektive, obgleich nur praktische Realität zu geben vermag und ihren transzendenten Gebrauch in einen immanenten (im Felde der Erfahrung durch Ideen selbst wirkende Ursachen zu sein) verwandelt.
Die Bestimmung der Kausalität der Wesen in der Sinnenwelt, als einer solchen, konnte niemals unbedingt sein, und dennoch muss es zu aller Reihe der Bedingungen notwendig etwas Unbedingtes, mithin auch eine sich gänzlich von selbst bestimmende Kausalität geben. Daher war die Idee der Freiheit, als eines Vermögens absoluter Spontaneität, nicht ein Bedürfnis, sondern, was deren Möglichkeit betrifft, ein analytischer Grundsatz der reinen spekulativen Vernunft. Allein, da es schlechterdings unmöglich ist, ihr gemäß ein Beispiel in irgendeiner Erfahrung zu geben, weil unter den Ursachen der Dinge, als Erscheinungen, keine Bestimmung der Kausalität, die schlechterdings unbedingt wäre, angetroffen werden kann, so konnten wir nur den Gedanken von einer freihandelnden Ursache, wenn wir diesen auf ein Wesen in der Sinnenwelt, sofern es andererseits auch als Noumenon betrachtet wird, anwenden, verteidigen, indem wir zeigten, dass es sich nicht widerspreche, alle seine Handlungen als physisch bedingt, sofern sie Erscheinungen sind, und doch zugleich die Kausalität derselben, sofern das handelnde Wesen ein Verstandeswesen ist, als physisch unbedingt anzusehen, und so den Begriff der Freiheit zum regulativen Prinzip der Vernunft zu machen, wodurch ich zwar den Gegenstand, dem dergleichen Kausalität beigelegt wird, gar nicht erkenne, was er sei, aber doch das Hindernis wegnehme, indem ich einerseits in der Erklärung der Weltbegebenheiten, mithin auch der Handlungen vernünftiger Wesen, dem Mechanismus der Naturnotwendigkeit, vom Bedingten zur Bedingung ins Unendliche zurückzugehen, Gerechtigkeit widerfahren lasse, andererseits aber der spekulativen Vernunft den für sie leeren Platz offen erhalte, nämlich das Intelligibele, um das Unbedingte dahin zu versetzen.
Ich konnte aber diesen Gedanken nicht realisieren, d.h. ihn nicht in Erkenntnis eines so handelnden Wesens, auch nur bloß seiner Möglichkeit nach, verwandeln. Diesen leeren Platz füllt nun reine praktische Vernunft, durch ein bestimmtes Gesetz der Kausalität in einer intelligibelen Welt (durch Freiheit), nämlich das moralische Gesetz, aus. Hierdurch wächst nun zwar der spekulativen Vernunft in Ansehung ihrer Einsicht nichts zu, aber doch in Ansehung der Sicherung ihres problematischen Begriffs der Freiheit, welchem hier objektive und obgleich nur praktische, dennoch unbezweifelte Realität verschafft wird. Selbst den Begriff der Kausalität, dessen Anwendung, mithin auch Bedeutung, eigentlich nur in Beziehung auf Erscheinungen, um sie zu Erfahrungen zu verknüpfen, stattfindet (wie die Kritik der reinen Vernunft beweist, erweitert sie nicht so, dass sie seinen Gebrauch über gedachte Grenzen ausdehne. Denn wenn sie darauf ausginge, so müsste sie zeigen wollen, wie das logische Verhältnis des Grundes und der Folge bei einer anderen Art von Anschauung, als die sinnliche ist, synthetisch gebraucht werden könne, d.h. wie causa noumenon möglich sei; welches sie gar nicht leisten kann, worauf sie aber auch als praktische Vernunft gar nicht Rücksicht nimmt, indem sie nur den Bestimmungsgrund der Kausalität des Menschen, als Sinnenwesens, (welche gegeben ist) in der reinen Vernunft (die darum praktisch heißt) setzt, und also den Begriff der Ursache selbst, von dessen Anwendung auf Objekte zum Behuf theoretischer Erkenntnisse sie hier gänzlich abstrahieren kann (weil dieser Begriff immer im Verstande, auch unabhängig von aller Anschauung, a priori angetroffen wird), nicht um Gegenstände zu erkennen, sondern die Kausalität in Ansehung derselben überhaupt zu bestimmen, also in keiner andern als praktischen Absicht braucht, und daher den Bestimmungsgrund des Willens in die intelligibele Ordnung der Dinge verlegen kann, indem sie zugleich gerne gesteht, das, was der Begriff der Ursache zur Erkenntnis dieser Dinge für eine Bestimmung haben möge, gar nicht zu verstehen.
Die Kausalität in Ansehung der Handlungen des Willens in der Sinnenwelt muss sie allerdings auf bestimmte Weise erkennen, denn sonst könnte praktische Vernunft wirklich keine Tat hervorbringen. Aber den Begriff, den sie von ihrer eigenen Kausalität als Noumenon macht, braucht sie nicht theoretisch zum Behuf der Erkenntnis ihrer übersinnlichen Existenz zu bestimmen, und also ihm so fern Bedeutung geben zu können. Denn Bedeutung bekommt er ohnedem, obgleich nur zum praktischen Gebrauch, nämlich durchs moralische Gesetz. Auch theoretisch betrachtet bleibt er immer ein reiner a priori gegebener Verstandesbegriff, der auf Gegenstände angewandt werden kann, sie mögen sinnlich oder nicht sinnlich gegeben werden; wiewohl er im letzteren Falle keine bestimmte theoretische Bedeutung und Anwendung hat, sondern bloß ein formaler, aber doch wesentlicher Gedanke des Verstandes von einem Objekte überhaupt ist. Die Bedeutung, die ihm die Vernunft durchs moralische Gesetz verschafft, ist lediglich praktisch, da nämlich die Idee des Gesetzes einer Kausalität (des Willens) selbst Kausalität hat, oder ihr Bestimmungsgrund ist.
Von dem Befugnisse der reinen Vernunft, im praktischen Gebrauch, zu einer Erweiterung, die ihr im spekulativen für sich nicht möglich ist
An dem moralischen Prinzip haben wir ein Gesetz der Kausalität aufgestellt, welches den Bestimmungsgrund der letzteren über alle Bedingungen der Sinnenwelt wegsetzt, und den Willen, wie er als zu einer intelligibelen Welt gehörig bestimmbar sei, mithin das Subjekt dieses Willens (den Menschen) nicht bloß als zu einer reinen Verstandeswelt gehörig, obgleich in dieser Beziehung als uns unbekannt (wie es nach der Kritik der reinen spekulativen Vernunft geschehen konnte) gedacht, sondern ihn auch in Ansehung seiner Kausalität, vermittelst eines Gesetzes, welches zu gar keinem Naturgesetze der Sinnenwelt gezählt werden kann, bestimmt, also unsere Erkenntnis über die Grenzen des letzteren erweitert, welche Anmaßung doch die Kritik der reinen Vernunft in aller Spekulation für nichtig erklärte.
Wie ist nun hier praktischer Gebrauch der reinen Vernunft mit dem theoretischen eben derselben, in Ansehung der Grenzbestimmung ihres Vermögens zu vereinigen?
David Hume, von dem man sagen kann, dass er alle Anfechtung der Rechte einer reinen Vernunft, welche eine gänzliche Untersuchung derselben notwendig machten, eigentlich anfing, schloss so. Der Begriff der Ursache ist ein Begriff, der die Notwendigkeit der Verknüpfung der Existenz des Verschiedenen, und zwar, sofern es verschieden ist, enthält, so, dass, wenn A gesetzt wird, ich erkenne, dass etwas davon ganz Verschiedenes, B, notwendig auch existieren müsse. Notwendigkeit kann aber nur einer Verknüpfung beigelegt werden, sofern sie a priori erkannt wird; denn die Erfahrung würde von einer Verbindung nur zu erkennen geben, dass sie sei, aber nicht, dass sie so notwendigerweise sei.
Nun ist es, sagt er, unmöglich, die Verbindung, die zwischen einem Ding und einem anderen (oder einer Bestimmung und einer anderen, ganz von ihr verschiedenen), wenn sie nicht in der Wahrnehmung gegeben werden, a priori und als notwendig zu erkennen. Also ist der Begriff einer Ursache selbst lügenhaft und betrügerisch, und ist, am gelindesten davon zu reden, eine sofern noch zu entschuldigende Täuschung, da die Gewohnheit (eine subjektive Notwendigkeit), gewisse Dinge oder ihre Bestimmungen, öfters neben, oder nacheinander ihrer Existenz nach, als sich beigesellt wahrzunehmen, unvermerkt für eine objektive Notwendigkeit, in den Gegenständen selbst eine solche Verknüpfung zu setzen, genommen, und so der Begriff einer Ursache erschlichen und nicht rechtmäßig erworben ist, ja auch niemals erworben oder beglaubigt werden kann, weil er eine an sich nichtige, chimärische, von keiner Vernunft haltbare Verknüpfung fordert, der gar kein Objekt jemals korrespondieren kann. So ward nun zuerst in Ansehung allen Erkenntnisses, das die Existenz der Dinge betrifft (die Mathematik blieb also davon noch ausgenommen), der Empirismus als die einzige Quelle der Prinzipien eingeführt, mit ihm aber zugleich der härteste Skeptizismus selbst in Ansehung der ganzen Naturwissenschaft (als Philosophie). Denn wir können nach solchen Grundsätzen niemals aus gegebenen Bestimmungen der Dinge ihrer Existenz nach auf eine Folge schließen (denn dazu würde der Begriff einer Ursache, der die Notwendigkeit einer solchen Verknüpfung enthält, erfordert werden), sondern nur, nach der Regel der Einbildungskraft, ähnliche Fälle, wie sonst, erwarten, welche Erwartung aber niemals sicher ist, sie mag auch noch so oft eingetroffen sein.
Ja, bei keiner Begebenheit könnte man sagen, es müsse etwas vor ihr vorhergegangen sein, worauf sie notwendig folgte, d.h. sie müsse eine Ursache haben, und also, wenn man auch noch so öftere Fälle kennen würde, wo dergleichen vorherging, so dass eine Regel davon abgezogen werden konnte, so könnte man darum es nicht als immer und notwendig sich auf die Art zutragend annehmen, und so müsse man dem blinden Zufall, bei welchem aller Vernunftgebrauch aufhört, auch sein Recht lassen, welches denn den Skeptizismus, in Ansehung der von Wirkungen zu Ursachen aufsteigenden Schlüsse, fest gründet und unwiderleglich macht.
Die Mathematik war so lange noch gut weggekommen, weil Hume dafür hielt, dass ihre Sätze alle analytisch wären, d.h. von einer Bestimmung zur andern, um der Identität willen, mithin nach dem Satze des Widerspruchs fortschritten (welches aber falsch ist, indem sie vielmehr alle synthetisch sind, und, obgleich z.B. die Geometrie es nicht mit der Existenz der Dinge, sondern nur ihrer Bestimmung a priori in einer möglichen Anschauung zu tun hat, dennoch ebenso gut, wie durch Kausalbegriffe, von einer Bestimmung A zu einer ganz verschiedenen B, als dennoch mit jener notwendig verknüpft, übergeht). Aber endlich muss jene wegen ihrer apodiktischen Gewissheit so hochgepriesene Wissenschaft doch dem Empirismus in Grundsätzen, aus demselben Grunde, warum Hume, an der Stelle der objektiven Notwendigkeit in dem Begriffe der Ursache, die Gewohnheit setzte, auch unterliegen, und sich, unangesehen alles ihres Stolzes, gefallen lassen, ihre kühne, a priori Beistimmung gebietenden Ansprüche herabzustimmen, und den Beifall für die Allgemeingültigkeit ihrer Sätze von der Gunst der Beobachter erwarten, die als Zeugen es doch nicht weigern würden zu gestehen, dass sie das, was der Geometer als Grundsätze vorträgt, jederzeit auch so wahrgenommen hätten, folglich, ob es gleich eben nicht notwendig wäre, doch fernerhin, es so erwarten zu dürfen, erlauben würden. Auf diese Weise führt Humens Empirismus in Grundsätzen auch unvermeidlich auf den Skeptizismus, selbst in Ansehung der Mathematik, folglich in allem wissenschaftlichen theoretischen Gebrauch der Vernunft (denn dieser gehört entweder zur Philosophie, oder zur Mathematik).
Ob der gemeine Vernunftgebrauch (bei einem so schrecklichen Umsturz, als man den Häuptern der Erkenntnis begegnen sieht) besser durchkommen, und nicht vielmehr, noch unwiederbringlicher, in eben diese Zerstörung alles Wissens werde verwickelt werden, mithin ein allgemeiner Skeptizismus nicht aus denselben Grundsätzen folgen müsse (der freilich aber nur die Gelehrten treffen würde), das will jeden selbst beurteilen lassen.
Was nun meine Bearbeitung in der Kritik der reinen Vernunft betrifft, die zwar durch jene Humische Zweifellehre veranlasst ward, doch viel weiter ging, und das ganze Feld der reinen theoretischen Vernunft im synthetischen Gebrauch, mithin auch desjenigen, was man Metaphysik überhaupt nennt, befasste, so verfuhr ich, in Ansehung der den Begriff der Kausalität betreffenden Zweifel des schottischen Philosophen, auf folgende Art. Dass Hume, wenn er (wie es doch auch fast überall geschieht) die Gegenstände der Erfahrung für Dinge an sich selbst nahm, den Begriff der Ursache für trüglich und falsches Blendwerk erklärte, daran tat er ganz recht; denn von Dingen an sich selbst und deren Bestimmungen als solchen kann nicht eingesehen werden, wie darum, weil etwas A gesetzt wird, etwas anderes B auch notwendig gesetzt werden müsse, und also konnte er eine solche Erkenntnis a priori von Dingen an sich selbst gar nicht einräumen. Einen empirischen Ursprung dieses Begriffs konnte der scharfsinnige Mann noch weniger anerkennen, weil dieser geradezu der Notwendigkeit der Verknüpfung widerspricht, welche das Wesentliche des Begriffs der Kausalität ausmacht; mithin ward der Begriff in die Acht erklärt, und in seine Stelle trat die Gewohnheit im Beobachten des Laufs der Wahrnehmungen.
Aus meinen Untersuchungen aber ergab es sich, dass die Gegenstände, mit denen wir es in der Erfahrung zu tun haben, keineswegs Dinge an sich selbst, sondern bloß Erscheinungen sind, und dass, obgleich bei Dingen an sich selbst gar nicht abzusehen ist, ja unmöglich ist einzusehen, wie, wenn A gesetzt wird, es widersprechend sein solle. B, welches von A ganz verschieden ist, nicht zu setzen (die Notwendigkeit der Verknüpfung zwischen A als Ursache und B als Wirkung), es sich doch ganz wohl denken lasse, dass sie als Erscheinungen in einer Erfahrung auf gewisse Weise (z.B. in Ansehung der Zeitverhältnisse) notwendig verbunden sein müssen und nicht getrennt werden können, ohne derjenigen Verbindung zu widersprechen, vermittelst deren diese Erfahrung möglich ist, in welcher sie als Gegenstände und für uns allein erkennbar sind. Und so fand es sich auch in der Tat, so, dass ich den Begriff der Ursache nicht allein nach seiner objektiven Realität in Ansehung der Gegenstände der Erfahrung beweisen, sondern ihn auch, als Begriff a priori, wegen der Notwendigkeit der Verknüpfung, die er bei sich führt, deduzieren, d.h. seine Möglichkeit aus reinem Verstande, ohne empirische Quellen, dartun, und so, nach Wegschaffung des Empirismus seines Ursprungs, die unvermeidliche Folge desselben, nämlich den Skeptizismus zuerst in Ansehung der Naturwissenschaft, dann auch, wegen des ganz vollkommen aus denselben Gründen Folgenden in Ansehung der Mathematik, beider Wissenschaften, die auf Gegenstände möglicher Erfahrung bezogen werden, und hiermit den totalen Zweifel an allem, was theoretische Vernunft einzusehen behauptet, aus dem Grunde heben konnte.
Aber wie wird es mit der Anwendung dieser Kategorie der Kausalität (und so auch aller übrigen; denn ohne sie lässt sich keine Erkenntnis des Existierenden zu Stande bringen) auf Dinge, die nicht Gegenstände möglicher Erfahrung sind, sondern über dieser ihre Grenze hinaus liegen?
Denn ich habe die objektive Realität dieser Begriffe nur in Ansehung der Gegenstände möglicher Erfahrung deduzieren können. Aber eben dieses, dass ich sie auch nur in diesem Falle gerettet habe, dass ich hingewiesen habe, es lassen sich dadurch doch Objekte denken, obgleich nicht a priori bestimmen, dieses ist es, was ihnen einen Platz im reinen Verstande gibt, von dem sie auf Objekte überhaupt (sinnliche oder nicht sinnliche) bezogen werden.
Wenn etwas noch fehlt, so ist es die Bedingung der Anwendung dieser Kategorien, und namentlich der der Kausalität, auf Gegenstände, nämlich die Anschauung, welche, wo sie nicht gegeben ist, die Anwendung zum Behuf der theoretischen Erkenntnis des Gegenstandes, als Noumenon, unmöglich macht, die also, wenn es jemand darauf wagt (wie auch in der Kritik der reinen Vernunft geschehen), gänzlich verwehrt wird, indessen, dass doch immer die objektive Realität des Begriffs bleibt, auch von Noumena gebraucht werden kann, aber ohne diesen Begriff theoretisch im mindesten bestimmen und dadurch ein Erkenntnis bewirken zu können. Denn, dass dieser Begriff auch in Beziehung auf ein Objekt nichts Unmögliches enthalte, war dadurch bewiesen, dass ihm sein Sitz im reinen Verstande bei aller Anwendung auf Gegenstände der Sinne gesichert war, und ob er gleich hernach etwa, auf Dinge an sich selbst (die nicht Gegenstände der Erfahrung sein können) bezogen, keiner Bestimmung, zur Vorstellung eines bestimmten Gegenstandes, zum Behuf einer theoretischen Erkenntnis, fähig ist, so konnte er doch immer noch zu irgendeinem anderen (vielleicht dem praktischen) Behuf einer Bestimmung zur Anwendung desselben fähig sein, welches nicht sein würde, wenn, nach Hume, dieser Begriff der Kausalität etwas, das überall zu denken unmöglich ist, enthielte.
Um nun diese Bedingung der Anwendung des gedachten Begriffs auf Noumena ausfindig zu machen, dürfen wir nur zurücksehen, weswegen wir nicht mit der Anwendung desselben auf Erfahrungsgegenstände zufrieden sind, sondern ihn auch gern von Dingen an sich selbst brauchen möchten. Denn da zeigt sich bald, dass es nicht eine theoretische, sondern praktische Absicht sei, welche uns dieses zur Notwendigkeit macht. Zur Spekulation würden wir, wenn es uns damit auch gelänge, doch keinen wahren Erwerb in Naturkenntnis und überhaupt in Ansehung der Gegenstände, die uns irgend gegeben werden mögen, machen, sondern allenfalls einen weiten Schritt vom Sinnlichbedingten (bei welchem zu bleiben und die Kette der Ursachen fleißig durchzuwandern wir so schon genug zu tun haben) zum Übersinnlichen tun und unser Erkenntnis von der Seite der Gründe zu vollenden und zu begrenzen, indessen dass immer eine unendliche Kluft zwischen jener Grenze und dem, was wir kennen, unausgefüllt übrig bliebe, und wir mehr einer eiteln Fragsucht, als einer gründlichen Wißbegierde, Gehör gegeben hätten.
Außer dem Verhältnisse aber, darin der Verstand zu Gegenständen (in der theoretischen Erkenntniss) steht, hat er auch eines zum Begehrungsvermögen, das darum der Wille heißt, und der reine Wille, sofern der reine Verstand (der in solchem Falle Vernunft heißt) durch die bloße Vorstellung eines Gesetzes praktisch ist. Die objektive Realität eines reinen Willens, oder, welches einerlei ist, einer reinen praktischen Vernunft ist im moralischen Gesetze a priori gleichsam durch ein Faktum gegeben; denn so kann man eine Willensbestimmung nennen, die unvermeidlich ist, ob sie gleich nicht auf empirischen Prinzipien beruht. Im Begriffe eines Willens aber ist der Begriff der Kausalität schon enthalten, mithin in dem eines reinen Willens der Begriff einer Kausalität mit Freiheit, d.h. die nicht nach Naturgesetzen bestimmbar, folglich keiner empirischen Anschauung als Beweises seiner Realität fähig ist, dennoch aber, in dem reinen praktischen Gesetze a priori, seine objektive Realität, doch (wie leicht einzusehen) nicht zum Behufe des theoretischen, sondern bloß praktischen Gebrauchs der Vernunft vollkommen rechtfertigt.
Nun ist der Begriff eines Wesens, das freien Willen hat, der Begriff einer causa noumenon und, dass sich dieser Begriff nicht selbst widerspreche, dafür ist man schon dadurch gesichert, dass der Begriff einer Ursache, als gänzlich vom reinen Verstande entsprungen, zugleich auch seiner objektiven Realität in Ansehung der Gegenstände überhaupt durch die Deduktion gesichert, dabei seinem Ursprung nach von allen sinnlichen Bedingungen unabhängig, also für sich auf Phänomene nicht eingeschränkt (es sei denn, wo ein theoretischer bestimmter Gebrauch davon gemacht werden wollte), auf Dinge als reine Verstandeswesen allerdings angewandt werden könne. Weil aber dieser Anwendung keine Anschauung, als die jederzeit nur sinnlich sein kann, untergelegt werden kann, so ist causa noumenon, in Ansehung des theoretischen Gebrauchs der Vernunft, obgleich ein möglicher, denkbarer, dennoch leerer Begriff. Nun verlange ich aber auch dadurch nicht die Beschaffenheit eines Wesens, sofern es einen reinen Willen hat, theoretisch zu kennen; es ist mir genug, es dadurch nur als ein solches zu bezeichnen, mithin nur den Begriff der Kausalität mit dem der Freiheit (und, was davon unzertrennlich ist, mit dem moralischen Gesetze, als Bestimmungsgrunde derselben) zu verbinden; welche Befugnis mir, vermöge des reinen, nicht empirischen Ursprungs des Begriffs der Ursache, allerdings zusteht, indem ich davon keinen anderen Gebrauch, als in Beziehung auf das moralische Gesetz, das seine Realität bestimmt, d.h. nur einen praktischen Gebrauch zu machen mich befugt halte.
Hätte ich, mit Humen, dem Begriff der Kausalität die objektive Realität im praktischen Gebrauch nicht allein in Ansehung der Sachen an sich selbst (des Übersinnlichen), sondern auch in Ansehung der Gegenstände der Sinne genommen, so wäre er aller Bedeutung verlustig und als ein theoretisch unmöglicher Begriff für gänzlich unbrauchbar erklärt worden; und, da von nichts sich auch kein Gebrauch machen lässt, der praktische Gebrauch eines theoretisch-nichtigen Begriffs ganz ungereimt gewesen. Nun aber der Begriff einer empirisch unbedingten Kausalität theoretisch zwar leer (ohne darauf sich schickende Anschauung), aber immer doch möglich ist und sich auf ein unbestimmtes Objekt bezieht, statt dieses aber ihm doch an dem moralischen Gesetze, folglich in praktischer Beziehung, Bedeutung gegeben wird, so habe ich zwar keine Anschauung, die ihm seine objektive theoretische Realität bestimmte, aber er hat nichts desto weniger wirkliche Anwendung, die sich in concreto in Gesinnungen oder Maximen darstellen läßt, d.h. praktische Realität, die angegeben werden kann; welches denn zu seiner Berechtigung selbst in Absicht auf Noumenon hinreichend ist.
Aber diese einmal eingeleitete objektive Realität eines reinen Verstandesbegriffs im Felde des Übersinnlichen gibt nunmehr allen übrigen Kategorien, obgleich immer nur, sofern sie mit dem Bestimmungsgrunde des reinen Willens (dem moralischen Gesetze) in notwendiger Verbindung stehen, auch objektive, nur keine andere als bloß praktisch-anwendbare Realität, indessen sie auf theoretische Erkenntnisse dieser Gegenstände, als Einsicht der Natur derselben durch reine Vernunft, nicht den mindesten Einfluss hat, um dieselbe zu erweitern. Wie wir denn auch in der Folge finden werden, dass sie immer nur auf Wesen als Intelligenzen, und an diesen auch nur auf das Verhältnis der Vernunft zum Willen, mithin immer nur aufs Praktische Beziehung haben und weiter hinaus sich keine Erkenntnis derselben anmaßen, was aber mit ihnen in Verbindung noch sonst für Eigenschaften, die zur theoretischen Vorstellungsart solcher übersinnlichen Dinge gehören, herbeigezogen werden möchten, diese insgesamt alsdann gar nicht zum Wissen, sondern nur zur Befugnis (in praktischer Absicht aber gar zur Notwendigkeit), sie anzunehmen und vorauszusetzen, gezählt werden, selbst da, wo man übersinnliche Wesen (als Gott) nach einer Analogie, d.i. dem reinen Vernunftverhältnisse, dessen wir in Ansehung der sinnlichen uns praktisch bedienen, und so der reinen theoretischen Vernunft durch die Anwendung aufs Übersinnliche, aber nur in praktischer Absicht, zum Schwärmen ins Überschwengliche nicht den mindesten Vorschub gibt.
Der Analytik der praktischen Vernunft zweites Hauptstück
Von dem Begriffe eines Gegenstandes der reinen praktischen Vernunft
Unter einem Begriff der praktischen Vernunft verstehe ich die Vorstellung eines Objekts als einer möglichen Wirkung durch Freiheit. Ein Gegenstand der praktischen Erkenntnis, als einer solchen, zu sein, bedeutet also nur die Beziehung des Willens auf die Handlung, dadurch er, oder sein Gegenteil, wirklichgemacht würde, und die Beurteilung, ob etwas ein Gegenstand der reinen praktischen Vernunft sei, oder nicht, ist nur die Unterscheidung der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, diejenige Handlung zu wollen, wodurch, wenn wir das Vermögen dazu hätten (worüber die Erfahrung urteilen muss), ein gewisses Objekt wirklich werden würde. Wenn das Objekt als der Bestimmungsgrund unseres Begehrungsvermögens angenommen wird, so muss die physische Möglichkeit desselben durch freien Gebrauch unserer Kräfte vor der Beurteilung, ob es ein Gegenstand der praktischen Vernunft sei oder nicht, vorangehen. Dagegen, wenn das Gesetz a priori als der Bestimmungsgrund der Handlung, mithin diese als durch reine praktische Vernunft bestimmt, betrachtet werden kann, so ist das Urteil, ob etwas ein Gegenstand der reinen praktischen Vernunft sei oder nicht, von der Vergleichung mit unserem physischen Vermögen ganz unabhängig, und die Frage ist nur, ob wir eine Handlung, die auf die Existenz eines Objekts gerichtet ist, wollen dürfen, wenn dieses in unserer Gewalt wäre, mithin muss die moralische Möglichkeit der Handlung vorangehen; denn da ist nicht der Gegenstand, sondern das Gesetz des Willens der Bestimmungsgrund derselben.
Die alleinigen Objekte einer praktischen Vernunft sind also die vom Guten und Bösen. Denn durch das erstere versteht man einen notwendigen Gegenstand des Begehrungs-, durch das zweite des Verabscheuungsvermögens, beides aber nach einem Prinzip der Vernunft. Wenn der Begriff des Guten nicht von einem vorhergehenden praktischen Gesetz abgeleitet werden, sondern diesem vielmehr zum Grund dienen soll, so kann er nur der Begriff von etwas sein, dessen Existenz Lust verheißt und so die Kausalität des Subjekts zur Hervorbringung desselben, d.h. das Begehrungsvermögen bestimmt. Weil es nun unmöglich ist, a priori einzusehen, welche Vorstellung mit Lust, welche hingegen mit Unlust werde begleitet sein, so käme es lediglich auf Erfahrung an, es auszumachen, was unmittelbar gut oder böse sei.
Die Eigenschaft des Subjekts, worauf in Beziehung diese Erfahrung allein angestellt werden kann, ist das Gefühl der Lust und Unlust, als eine dem inneren Sinne angehörige Rezeptivität und so würde der Begriff von dem, was unmittelbar gut ist, nur auf das gehen, womit die Empfindung des Vergnügens unmittelbar verbunden ist, und der von dem schlechthin (-)Bösen auf das, was unmittelbar Schmerz erregt, allein bezogen werden müssen. Weil aber das dem Sprachgebrauch schon zuwider ist, der das Angenehme vom Guten, das Unangenehme vom Bösen unterscheidet, und verlangt, dass Gutes und Böses jederzeit durch Vernunft, mithin durch Begriffe, die sich allgemein mitteilen lassen, und nicht durch bloße Empfindung, welche sich auf einzelne Objekte und deren Empfänglichkeit einschränkt, beurteilt werde, gleichwohl aber für sich selbst mit keiner Vorstellung eines Objekts a priori eine Lust oder Unlust unmittelbar verbunden werden kann, so würde der Philosoph, der sich genötigt glaubte, ein Gefühl der Lust seiner praktischen Beurteilung zu Grunde zu legen, gut nennen, was ein Mittel zum Angenehmen, und Böses, was Ursache der Unannehmlichkeit und des Schmerzens ist; denn die Beurteilung des Verhältnisses der Mittel zu Zwecken gehört allerdings zur Vernunft. Obgleich aber Vernunft, allein vermögend ist, die Verknüpfung der Mittel mit ihren Absichten einzusehen (so dass man auch den Willen durch das Vermögen der Zwecke definieren könnte, indem sie jederzeit Bestimmungsgründe des Begehrungsvermögens nach Prinzipien sind), so würden doch die praktischen Maximen, die aus dem obigen Begriffe des Guten bloß als Mittel folgten, nie etwas für sich selbst, sondern immer nur irgend wozu Gutes zum Gegenstande des Willens enthalten, das Gute würde jederzeit bloß das Nützliche sein, und das, wozu es nutzt, müsste allemal außerhalb des Willens in der Empfindung liegen. Wenn diese nun, als angenehme Empfindung, vom Begriffe des Guten unterschieden werden müsste so würde es überall nichts unmittelbar Gutes geben, sondern das Gute nur in den Mitteln zu etwas anderem, nämlich irgendeiner Annehmlichkeit, gesucht werden müssen.
Es ist eine alte Formel der Schulen, nihil appetimus, nisi sub ratione boni; nihil aversamur, nisi sub ratione mali; und sie hat einen oft richtigen, aber auch der Philosophie oft sehr nachteiligen Gebrauch, weil die Ausdrücke des boni und mali eine Zweideutigkeit enthalten, daran die Einschränkung der Sprache schuld ist, nach welcher sie eines doppelten Sinnes fähig sind, und daher die praktischen Gesetze unvermeidlich auf Schrauben stellen, und die Philosophie, die im Gebrauch derselben gar wohl der Verschiedenheit des Begriffs bei demselben Worte inne werden, aber doch keine besonderen Ausdrücke dafür finden kann, zu subtilen Distinktionen nötigen, über die man sich nachher nicht einigen kann, indem der Unterschied durch keinen angemessenen Ausdruck unmittelbar bezeichnet werden konnte.
Die deutsche Sprache hat das Glück, die Ausdrücke zu besitzen, welche diese Verschiedenheit nicht übersehen lassen. Für das, was die Lateiner mit einem einzigen Worte bonum benennen, hat sie zwei sehr verschiedene Begriffe, und auch ebenso verschiedene Ausdrücke. Für bonum das Gute und das Wohl, für malum das Böse und das Übel (oder Weh), so dass es zwei ganz verschiedene Beurteilungen sind, ob wir bei einer Handlung das Gute und Böse derselben, oder unser Wohl und Weh (Übel) in Betrachtung ziehen. Hieraus folgt schon, dass obiger psychologischer Satz wenigstens noch sehr ungewiss sei, wenn er so übersetzt wird, wir begehren nichts, als in Rücksicht auf unser Wohl oder Weh; dagegen er, wenn man ihn so gibt, wir wollen, nach Anweisung der Vernunft, nichts, als nur sofern wir es für gut oder böse halten, ungezweifelt gewiss und zugleich ganz klar ausgedrückt wird.
Das Wohl oder Übel bedeutet immer nur eine Beziehung auf unseren Zustand der Annehmlichkeit oder Unannehmlichkeit, des Vergnügens und Schmerzens, und, wenn wir darum ein Objekt begehren, oder verabscheuen, so geschieht es, nur sofern es auf unsere Sinnlichkeit und das Gefühl der Lust und Unlust, das es bewirkt, bezogen wird.
Das Gute oder Böse bedeutet aber jederzeit eine Beziehung auf den Willen, sofern dieser durchs Vernunftgesetz bestimmt wird, sich etwas zu seinem Objekte zu machen; wie er denn durch das Objekt und dessen Vorstellung niemals unmittelbar bestimmt wird, sondern ein Vermögen ist, sich eine Regel der Vernunft zur Bewegursache einer Handlung (dadurch ein Objekt wirklich werden kann) zu machen. Das Gute oder Böse wird also eigentlich auf Handlungen, nicht auf den Empfindungszustand der Person bezogen, und, sollte etwas schlechthin (und in aller Absicht und ohne weitere Bedingung) gut oder böse sein, oder dafür gehalten werden, so würde es nur die Handlungsart, die Maxime des Willens und mithin die handelnde Person selbst, als guter oder böser Mensch, nicht aber eine Sache sein, die so genannt werden könnte.
Man mochte also immer den Stoiker auslachen, der in den heftigsten Gichtschmerzen ausrief: Schmerz, du magst mich noch so sehr foltern, ich werde doch nie gestehen, dass du etwas Böses (kakon, malum) seist! Er hatte doch recht. Ein Übel war es, das fühlte er, und das verriet sein Geschrei, aber dass ihm dadurch ein Böses anhinge, hatte er gar nicht Ursache einzuräumen; denn der Schmerz verringert den Wert seiner Person nicht im Mindesten, sondern nur den Wert seines Zustandes. Eine einzige Lüge, deren er sich bewusst gewesen wäre, hätte seinen Mut niederschlagen müssen; aber der Schmerz diente nur zur Veranlassung, ihn zu erheben, wenn er sich bewusst war, dass er sie durch keine unrechte Handlung verschuldet und sich dadurch strafwürdig gemacht habe.
Was wir gut nennen sollen, muss in jedes vernünftigen Menschen Urteil ein Gegenstand des Begehrungsvermögens sein, und das Böse in den Augen von jedermann ein Gegenstand des Abscheues; mithin bedarf es, außer dem Sinne, zu dieser Beurteilung noch Vernunft. So ist es mit der Wahrhaftigkeit im Gegensatz mit der Lüge, so mit der Gerechtigkeit im Gegensatz der Gewalttätigkeit etc. bewandt. Wir können aber etwas ein Übel nennen, welches doch jedermann zugleich für gut, bisweilen mittelbar, bisweilen gar für unmittelbar erklären muss. Der eine chirurgische Operation an sich verrichten lässt, fühlt sie ohne Zweifel als ein Übel; aber durch Vernunft erklärt er, und jedermann, sie für gut. Wenn aber jemand, der friedliebende Leute gerne neckt und beunruhigt, endlich einmal anläuft und mit einer tüchtigen Tracht Schläge abgefertigt wird, so ist dieses allerdings ein Übel, aber jedermann gibt dazu seinen Beifall und hält es an sich für gut, wenn auch nichts weiter daraus entspränge; ja selbst der, der sie empfängt, muss in seiner Vernunft erkennen, dass ihm Recht geschehe, weil er die Proportion zwischen dem Wohlbefinden und Wohlverhalten, welche die Vernunft ihm unvermeidlich vorhält, hier genau in Ausübung gebracht sieht.
Es kommt allerdings auf unser Wohl und Weh in der Beurteilung unserer praktischen Vernunft gar sehr viel, und, was unsere Natur als sinnliche Wesen betrifft, alles auf unsere Glückseligkeit an, wenn diese, wie Vernunft es vorzüglich fordert, nicht nach der vorübergehenden Empfindung, sondern nach dem Einfluss den diese Zufälligkeit auf unsere ganze Existenz und die Zufriedenheit mit derselben hat, beurteilt wird; aber alles überhaupt kommt darauf doch nicht an. Der Mensch ist ein bedürftiges Wesen, sofern er zur Sinnenwelt gehört und sofern hat seine Vernunft allerdings einen nicht abzulehnenden Auftrag, von Seiten der Sinnlichkeit, sich um das Interesse derselben zu bekümmern und sich praktische Maximen, auch in Absicht auf die Glückseligkeit dieses, und, womöglich, auch eines zukünftigen Lebens, zu machen. Aber er ist doch nicht so ganz Tier, um gegen alles, was Vernunft für sich selbst sagt, gleichgültig zu sein, und diese bloß zum Werkzeug der Befriedigung seines Bedürfnisses, als Sinnenwesens, zu gebrauchen. Denn im Wert über die bloße Tierheit erhebt ihn das gar nicht, dass er Vernunft hat, wenn sie ihm nur zum Behuf desjenigen dienen soll, was bei Tieren der Instinkt verrichtet; sie wäre alsdann nur eine besondere Manier, deren sich die Natur bedient hätte, um den Menschen zu demselben Zwecke, dazu sie Tiere bestimmt hat, auszurüsten, ohne ihn zu einem höheren Zwecke zu bestimmen.
Er bedarf also freilich, nach dieser einmal mit ihm getroffenen Naturanstalt, Vernunft, um sein Wohl und Weh jederzeit in Betrachtung zu ziehen, aber er hat sie überdem noch zu einem höheren Behuf, nämlich auch das, was an sich gut oder böse ist, und worüber reine, sinnlich gar nicht interessierte Vernunft nur allein urteilen kann, nicht allein mit in Überlegung zu nehmen, sondern diese Beurteilung von jener gänzlich zu unterscheiden, und sie zur obersten Bedingung des letzteren zu machen.
In dieser Beurteilung des an sich Guten und Bösen, zum Unterschiede von dem, was nur beziehungsweise auf Wohl oder Übel so genannt werden kann, kommt es auf folgende Punkte an. Entweder ein Vernunftprinzip wird schon an sich als der Bestimmungsgrund des Willens gedacht, ohne Rücksicht auf mögliche Objekte des Begehrungsvermögens (also bloß durch die gesetzliche Form der Maxime), alsdann ist jenes Prinzip praktisches Gesetz a priori, und reine Vernunft wird für sich praktisch zu sein angenommen. Das Gesetz bestimmt alsdann unmittelbar den Willen, die ihm gemäße Handlung ist an sich selbst gut, ein Wille, dessen Maxime jederzeit diesem Gesetz gemäß ist, ist schlechterdings, in aller Absicht, gut, und die oberste Bedingung alles Guten; oder es geht ein Bestimmungsgrund des Begehrungsvermögens vor der Maxime des Willens vorher, der ein Objekt der Lust und Unlust voraussetzt, mithin etwas, das vergnügt oder schmerzt, und die Maxime der Vernunft, jene zu befördern, diese zu vermeiden, bestimmt die Handlungen, wie sie beziehungsweise auf unsere Neigung, mithin nur mittelbar (in Rücksicht auf einen anderweitigen Zweck, als Mittel zu demselben) gut sind, und diese Maximen können alsdann niemals Gesetze, dennoch aber vernünftige, praktische Vorschriften heißen.
Der Zweck selbst, das Vergnügen, das wir suchen, ist im letzteren Falle nicht ein Gutes, sondern ein Wohl, nicht ein Begriff der Vernunft, sondern ein empirischer Begriff von einem Gegenstand der Empfindung; allein der Gebrauch des Mittels dazu, d.h. die Handlung (weil dazu vernünftige Überlegung erfordert wird) heißt dennoch gut, aber nicht schlechthin, sondern nur in Beziehung auf unsere Sinnlichkeit, in Ansehung ihres Gefühls der Lust und Unlust; der Wille aber, dessen Maxime dadurch affiziert wird, ist nicht ein reiner Wille, der nur auf das geht, wobei reine Vernunft für sich selbst praktisch sein kann.
Hier ist nun der Ort, das Paradoxon der Methode in einer Kritik der praktischen Vernunft zu erklären, dass nämlich der Begriff des Guten und Bösen nicht vor dem moralischen Gesetz (dem es dem Anschein nach sogar zum Grunde gelegt werden müsste), sondern nur (wie hier auch geschieht) nach demselben und durch dasselbe bestimmt werden müsse. Wenn wir nämlich auch nicht wüssten, dass das Prinzip der Sittlichkeit ein reines a priori den Willen bestimmendes Gesetz sei, so müssten wir doch, um nicht ganz umsonst (gratis) Grundsätze anzunehmen, es anfänglich wenigstens unausgemacht lassen, ob der Wille bloß empirische oder auch reine Bestimmungsgründe a priori habe; denn es ist wider alle Grundregeln des philosophischen Verfahrens, das, worüber man allererst entscheiden soll, schon im Voraus als entschieden anzunehmen. Gesetzt, wir wollten nun vom Begriffe des Guten anfangen, um davon die Gesetze des Willens abzuleiten, so würde dieser Begriff von einem Gegenstande (als einem guten) zugleich diesen, als den einigen Bestimmungsgrund des Willens, angeben. Weil nun dieser Begriff kein praktisches Gesetz a priori zu seiner Richtschnur hatte, so könnte der Probierstein des Guten oder Bösen in nichts anderes, als in der Übereinstimmung des Gegenstandes mit unserem Gefühl der Lust oder Unlust gesetzt werden, und der Gebrauch der Vernunft könnte nur darin bestehen, teils diese Lust oder Unlust im ganzen Zusammenhange mit allen Empfindungen meines Daseins, teils die Mittel, mir den Gegenstand derselben zu verschaffen, zu bestimmen.
Da nun, was dem Gefühle der Lust gemäß sei, nur durch Erfahrung ausgemacht werden kann, das praktische Gesetz aber, der Angabe nach, doch darauf, als Bedingung, gegründet werden soll, so würde geradezu die Möglichkeit praktischer Gesetze a priori ausgeschlossen; weil man vorher nötig zu finden meinte, einen Gegenstand für den Willen auszufinden, davon der Begriff, als eines Guten, den allgemeinen, obzwar empirischen Bestimmungsgrund des Willens ausmachen müsse. Nun aber war doch vorher nötig zu untersuchen, ob es nicht auch einen Bestimmungsgrund des Willens a priori gebe (welcher niemals irgendwo anders, als an einem reinen praktischen Gesetz, und zwar sofern dieses die bloße gesetzliche Form, ohne Rücksicht auf einen Gegenstand, den Maximen vorschreibt, wäre gefunden worden).
Weil man aber schon einen Gegenstand nach Begriffen des Guten und Bösen zum Grunde alles praktischen Gesetzes legte, jener aber ohne vorhergehendes Gesetz nur nach empirischen Begriffen gedacht werden konnte, so hatte man sich die Möglichkeit, ein reines praktisches Gesetz auch nur zu denken, schon zum Voraus benommen; da man im Gegenteil, wenn man dem letzteren vorher analytisch nachgeforscht hätte, gefunden haben würde, dass nicht der Begriff des Guten, als eines Gegenstandes, das moralische Gesetz, sondern umgekehrt das moralische Gesetz allererst den Begriff des Guten, sofern es diesen Namen schlechthin verdient, bestimme und möglich mache.
Diese Anmerkung, welche bloß die Methode der obersten moralischen Untersuchungen betrifft, ist von Wichtigkeit. Sie erklärt auf einmal den veranlassenden Grund aller Verirrungen der Philosophen in Ansehung des obersten Prinzips der Moral. Denn sie suchten einen Gegenstand des Willens auf, um ihn zur Materie und dem Grunde eines Gesetzes zu machen (welches alsdann nicht unmittelbar, sondern vermittelst jenes an das Gefühl der Lust oder Unlust gebrachten Gegenstandes, der Bestimmungsgrund des Willens sein sollte, anstatt dass sie zuerst nach einem Gesetz hätten forschen sollen, das a priori und unmittelbar den Willen, und diesem gemäß allererst den Gegenstand bestimmte). Nun mochten sie diesen Gegenstand der Lust, der den obersten Begriff des Guten abgeben sollte, in der Glückseligkeit, in der Vollkommenheit, im moralischen Gesetz oder im Willen Gottes setzen, so war ihr Grundsatz allemal Heteronomie, sie mussten unvermeidlich auf empirische Bedingungen zu einem moralischen Gesetz stoßen, weil sie ihren Gegenstand, als unmittelbaren Bestimmungsgrund des Willens, nur nach seinem unmittelbaren Verhalten zum Gefühl, welches allemal empirisch ist, gut oder böse nennen konnten.
Nur ein formales Gesetz, d.h. ein solches, welches der Vernunft nichts weiter als die Form ihrer allgemeinen Gesetzgebung zur obersten Bedingung der Maximen vorschreibt, kann a priori ein Bestimmungsgrund der praktischen Vernunft sein. Die Alten verrieten indessen diesen Fehler dadurch unverhohlen, dass sie ihre moralische Untersuchung gänzlich auf die Bestimmung des Begriffs vom höchsten Gut, mithin eines Gegenstandes setzten, welchen sie nachher zum Bestimmungsgrunde des Willens im moralischen Gesetz zu machen gedachten, ein Objekt, welches weit hinterher, wenn das moralische Gesetz allererst für sich bewährt und als unmittelbarer Bestimmungsgrund des Willens gerechtfertigt ist, dem nunmehr seiner Form nach a priori bestimmten Willen als Gegenstand vorgestellt werden kann, welches wir in der Dialektik der reinen praktischen Vernunft uns unterfangen wollen. Die Neueren, bei denen die Frage über das höchste Gut außer Gebrauch gekommen, zum wenigsten nur Nebensache geworden zu sein scheint, verstecken obigen Fehler (wie in vielen andern Fällen) hinter unbestimmten Worten, indessen, dass man ihn gleichwohl aus ihren Systemen hervorblicken sieht, da er alsdann allenthalben Heteronomie der praktischen Vernunft verrät, daraus nimmermehr ein a priori allgemein gebietendes moralisches Gesetz entspringen kann.
Da nun die Begriffe des Guten und Bösen, als Folgen der Willensbestimmung a priori, auch ein reines praktisches Prinzip, mithin eine Kausalität der reinen Vernunft voraussetzen, so beziehen sie sich, ursprünglich, nicht (etwa als Bestimmungen der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen gegebener Anschauungen in einem Bewusstsein) auf Objekte, wie die reinen Verstandesbegriffe oder Kategorien der theoretisch-gebrauchten Vernunft, sie setzen diese vielmehr als gegeben voraus; sondern sie sind insgesamt Modi einer einzigen Kategorie, nämlich der der Kausalität, sofern der Bestimmungsgrund derselben in der Vernunftvorstellung eines Gesetzes derselben besteht, welches, als Gesetz der Freiheit, die Vernunft sich selbst gibt und dadurch sich a priori als praktisch beweist. Da indessen die Handlungen einerseits zwar unter einem Gesetz, das kein Naturgesetz, sondern ein Gesetz der Freiheit ist, folglich zu dem Verhalten intelligibeler Wesen, andererseits aber doch auch, als Begebenheiten in der Sinnenwelt, zu den Erscheinungen gehören, so werden die Bestimmungen einer praktischen Vernunft nur in Beziehung auf die letztere, folglich zwar den Kategorien des Verstandes gemäß, aber nicht in der Absicht eines theoretischen Gebrauchs desselben, um das Mannigfaltige der (sinnlichen) Anschauung unter ein Bewusstsein a priori zu bringen, sondern nur, um das Mannigfaltige der Begehrungen der Einheit des Bewusstseins einer im moralischen Gesetz gebietenden praktischen Vernunft, oder eines reinen Willens a priori zu unterwerfen.
Diese Kategorien der Freiheit, denn so wollen wir sie, statt jener theoretischen Begriffe, als Kategorien der Natur, benennen, haben einen augenscheinlichen Vorzug vor den letzteren, dass, da diese nur Gedankenformen sind, welche nur unbestimmt Objekte überhaupt für jede uns mögliche Anschauung durch allgemeine Begriffe bezeichnen, diese hingegen, da sie auf die Bestimmung einer freien Willkür gehen (der zwar keine Anschauung, völlig korrespondierend, gegeben werden kann, die aber, welches bei keinen Begriffen des theoretischen Gebrauchs unseres Erkenntnisvermögens stattfindet, ein reines praktisches Gesetz a priori zum Grunde liegen hat), als praktische Elementarbegriffe statt der Form der Anschauung (Raum und Zeit), die nicht in der Vernunft selbst liegt, sondern anderwärts, nämlich von der Sinnlichkeit, hergenommen werden muss, die Form eines reinen Willens in ihr, mithin dem Denkungsvermögen selbst, als gegeben zum Grunde liegen haben; dadurch es denn geschieht, dass, da es in allen Vorschriften der reinen praktischen Vernunft nur um die Willensbestimmung, nicht um die Naturbedingungen (des praktischen Vermögens) der Ausführung seiner Absicht zu tun ist, die praktischen Begriffe a priori in Beziehung auf das oberste Prinzip der Freiheit sogleich Erkenntnisse werden und nicht auf Anschauungen warten dürfen, um Bedeutung zu bekommen, und zwar aus diesem merkwürdigen Grunde, weil sie die Wirklichkeit dessen, worauf sie sich beziehen (die Willensgesinnung), selbst hervorbringen, welches gar nicht die Sache theoretischer Begriffe ist.
Nur muss man wohl bemerken, dass diese Kategorien nur die praktische Vernunft überhaupt angehen, und so in ihrer Ordnung, von den moralisch noch unbestimmten, und sinnlich-bedingten, zu denen, die, sinnlich-unbedingt, bloß durchs moralische Gesetz bestimmt sind, fortgehen.
Man wird hier bald gewahr, dass in dieser Tafel die Freiheit, als eine Art von Kausalität, die aber empirischen Bestimmungsgründen nicht unterworfen ist, in Ansehung der durch sie möglichen Handlungen, als Erscheinungen in der Sinnenwelt, betrachtet werde, folglich sich auf die Kategorien ihrer Naturmöglichkeit beziehe, indessen dass doch jede Kategorie so allgemein genommen wird, dass der Bestimmungsgrund jener Kausalität auch außer der Sinnenwelt in der Freiheit als Eigenschaft eines intelligibelen Wesens angenommen werden kann, bis die Kategorien der Modalität den Übergang von praktischen Prinzipien überhaupt zu denen der Sittlichkeit, aber nur problematisch, einleiten, welche nachher durchs moralische Gesetz allererst dogmatisch dargestellt werden können.
Ich füge hier nichts weiter zur Erläuterung gegenwärtiger Tafel bei, weil sie für sich verständlich genug ist. Dergleichen nach Prinzipien abgefasste Einteilung ist aller Wissenschaft, ihrer Gründlichkeit sowohl als Verständlichkeit halber, sehr zuträglich. So weiß man z.B. aus obiger Tafel und der ersten Nummer derselben sogleich, wovon man in praktischen Erwägungen anfangen müsse, von den Maximen, die jeder auf seine Neigung gründet, den Vorschriften, die für eine Gattung vernünftiger Wesen, sofern sie in gewissen Neigungen übereinkommen, gelten, und endlich dem Gesetz, welches für alle, unangesehen ihrer Neigungen, gilt, usw. Auf diese Weise übersieht man den ganzen Plan, von dem, was man zu leisten hat, sogar jede Frage der praktischen Philosophie, die zu beantworten, und zugleich die Ordnung, die zu befolgen ist.
Von der Typik der reinen praktischen Urteilskraft
Die Begriffe des Guten und Bösen bestimmen dem Willen zuerst ein Objekt. Sie stehen selbst aber unter einer praktischen Regel der Vernunft, welche, wenn sie reine Vernunft ist, den Willen a priori in Ansehung seines Gegenstandes bestimmt. Ob nun eine uns in der Sinnlichkeit mögliche Handlung der Fall sei, der unter der Regel stehe, oder nicht, dazu gehört praktische Urteilskraft, wodurch dasjenige, was in der Regel allgemein (in abstracto) gesagt wurde, auf eine Handlung in concreto angewandt wird. Weil aber eine praktische Regel der reinen Vernunft erstlich, als praktisch, die Existenz eines Objekts betrifft, und zweitens, als praktische Regel der reinen Vernunft Notwendigkeit in Ansehung des Daseins der Handlung bei sich führt, mithin praktisches Gesetz ist, und zwar nicht Naturgesetz, durch empirische Bestimmungsgründe, sondern ein Gesetz der Freiheit, nach welchem der Wille, unabhängig von allem Empirischen (bloß durch die Vorstellung eines Gesetzes überhaupt und dessen Form) bestimmbar sein soll, alle vorkommenden Fälle zu möglichen Handlungen aber nur empirisch, d.h. zur Erfahrung und Natur gehörig sein können, so scheint es widersinnig, in der Sinnenwelt einen Fall antreffen zu wollen, der, da er immer sofern nur unter dem Naturgesetz steht, doch die Anwendung eines Gesetzes der Freiheit auf sich verstatte, und auf welchen die übersinnliche Idee des Sittlichguten, das darin in concreto dargestellt werden soll, angewandt werden könne.
Also ist die Urteilskraft der reinen praktischen Vernunft eben denselben Schwierigkeiten unterworfen, als die der reinen theoretischen, welche letztere gleichwohl, aus denselben zu kommen, ein Mittel zur Hand hatte; nämlich, da es in Ansehung des theoretischen Gebrauchs auf Anschauungen ankam, darauf reine Verstandesbegriffe angewandt werden könnten, dergleichen Anschauungen (obzwar nur von Gegenständen der Sinne) doch a priori, mithin, was die Verknüpfung des Mannigfaltigen in denselben betrifft, den reinen Verstandesbegriffen a priori gemäß (als Schemata) gegeben werden können. Hingegen ist das sittlich-Gute etwas dem Objekt nach Übersinnliches, für das also in keiner sinnlichen Anschauung etwas Korrespondierendes gefunden werden kann, und die Urteilskraft unter Gesetzen der reinen praktischen Vernunft scheint daher besonderen Schwierigkeiten unterworfen zu sein, die darauf beruhen, dass ein Gesetz der Freiheit auf Handlungen, als Begebenheiten, die in der Sinnenwelt geschehen, und also sofern zur Natur gehören, angewandt werden soll.
Allein hier eröffnet sich doch wieder eine günstige Aussicht für die reine praktische Urteilskraft. Es ist bei der Subsumtion einer mir in der Sinnenwelt möglichen Handlung unter einem reinen praktischen Gesetz nicht um die Möglichkeit der Handlung, als einer Begebenheit in der Sinnenwelt, zu tun; denn die gehört für die Beurteilung des theoretischen Gebrauchs der Vernunft, nach dem Gesetz der Kausalität, eines reinen Verstandesbegriffs, für den sie ein Schema in der sinnlichen Anschauung hat. Die physische Kausalität, oder die Bedingung, unter der sie stattfindet, gehört unter die Naturbegriffe, deren Schema transzendentale Einbildungskraft entwirft. Hier aber ist es nicht um das Schema eines Falles nach Gesetzen, sondern um das Schema (wenn dieses Wort hier schicklich ist) eines Gesetzes selbst zu tun, weil die Willensbestimmung (nicht der Handlung in Beziehung auf ihren Erfolg) durchs Gesetz allein, ohne einen anderen Bestimmungsgrund, den Begriff der Kausalität an ganz andere Bedingungen bindet, als diejenigen sind, welche die Naturverknüpfung ausmachen.
Dem Naturgesetz als Gesetz, welchem die Gegenstände sinnlicher Anschauung als solche unterworfen sind, muss ein Schema, d.h. ein allgemeines Verfahren der Einbildungskraft (den reinen Verstandesbegriff, den das Gesetz bestimmt, den Sinnen a priori darzustellen), korrespondieren. Aber dem Gesetz der Freiheit (als einer gar nicht sinnlich bedingten Kausalität), mithin auch dem Begriff des unbedingt Guten, kann keine Anschauung, mithin kein Schema zum Behuf seiner Anwendung in concreto untergelegt werden. Folglich hat das Sittengesetz kein anderes, die Anwendung desselben auf Gegenstände der Natur vermittelndes Erkenntnisvermögen, als den Verstand (nicht die Einbildungskraft), welcher einer Idee der Vernunft nicht ein Schema der Sinnlichkeit, sondern ein Gesetz, aber doch ein solches, das an Gegenständen der Sinne in concreto dargestellt werden kann, mithin ein Naturgesetz, aber nur seiner Form nach, als Gesetz zum Behuf der Urteilskraft unterlegen kann, und dieses können wir daher den Typus des Sittengesetzes nennen.
Die Regel der Urteilskraft unter Gesetzen der reinen praktischen Vernunft ist diese: Frage dich selbst, ob die Handlung, die du vorhast, wenn sie nach einem Gesetz der Natur, von der du selbst ein Teil wärest, geschehen sollte, die du wohl, als durch deinen Willen möglich, ansehen könntest. Nach dieser Regel beurteilt in der Tat jedermann Handlungen, ob sie sittlich-gut oder böse sind.
So sagt man, wie, wenn ein jeder, wo er seinen Vorteil zu schaffen glaubt, sich erlaubte, zu betrügen, oder befugt hielte, sich das Leben abzukürzen, so bald ihn ein völliger Überdruß desselben befällt, oder anderer Not mit völliger Gleichgültigkeit ansähe, und du gehörtest mit zu einer solchen Ordnung der Dinge, würdest du darin wohl mit Einstimmung deines Willens sein?
Nun weiß ein jeder wohl, dass, wenn er sich insgeheim Betrug erlaubt, darum eben nicht jedermann es auch tue, oder wenn er unbemerkt lieblos ist, nicht sofort jedermann auch gegen ihn es sein würde; daher ist dieser Vergleich der Maxime seiner Handlungen mit einem allgemeinen Naturgesetze auch nicht der Bestimmungsgrund seines Willens. Aber das letztere ist doch ein Typus der Beurteilung der ersteren nach sittlichen Prinzipien. Wenn die Maxime der Handlung nicht so beschaffen ist, dass sie an der Form eines Naturgesetzes überhaupt die Probe hält, so ist sie sittlich-unmöglich. So urteilt selbst der gemeinste Verstand; denn das Naturgesetz liegt allen seinen gewöhnlichsten, selbst den Erfahrungsurteilen immer zum Grunde. Er hat es also jederzeit bei der Hand, nur dass er in Fällen, wo die Kausalität aus Freiheit beurteilt werden soll, jenes Naturgesetz bloß zum Typus eines Gesetzes der Freiheit macht, weil er, ohne etwas, was er zum Beispiel im Erfahrungsfalle machen könnte, bei Hand zu haben, dem Gesetz einer reinen praktischen Vernunft nicht den Gebrauch in der Anwendung verschaffen könnte.
Es ist also auch erlaubt, die Natur der Sinnenwelt als Typus einer intelligibelen Natur zu brauchen, so lange ich nur nicht die Anschauungen, und was davon abhängig ist, auf diese übertrage, sondern bloß die Form der Gesetzmäßigkeit überhaupt (deren Begriff auch im reinsten Vernunftgebrauch stattfindet, aber in keiner anderen Absicht, als bloß zum reinen praktischen Gebrauch der Vernunft, a priori bestimmt erkannt werden kann) darauf beziehe. Denn Gesetze, als solche, sind sofern einerlei, sie mögen ihre Bestimmungsgründe hernehmen, woher sie wollen.
Übrigens, da von allem Intelligibelen schlechterdings nichts als (vermittelst des moralischen Gesetzes) die Freiheit, und auch diese nur, sofern sie eine von jenem unzertrennliche Voraussetzung ist, und ferner alle intelligibele Gegenstände, auf welche uns die Vernunft, nach Anleitung jenes Gesetzes, etwa noch führen möchte, wiederum für uns keine Realität weiter haben, als zum Behuf desselben Gesetzes und des Gebrauches der reinen praktischen Vernunft, diese aber zum Typus der Urteilskraft die Natur (der reinen Verstandesform derselben nach) zu gebrauchen berechtigt und auch benötigt ist, so dient die gegenwärtige Anmerkung dazu, um zu verhüten, dass, was bloß zur Typik der Begriffe gehört, nicht zu den Begriffen selbst gezählt werde.
Diese also, als Typik der Urteilskraft, bewahrt für den Empirismus der praktischen Vernunft, der die praktischen Begriffe, des Guten und Bösen, bloß in Erfahrungsfolgen (der sogenannten Glückseligkeit) setzt, obzwar diese und die unendlichen nützlichen Folgen eines durch Selbstliebe bestimmten Willens, wenn dieser sich selbst zugleich zum allgemeinen Naturgesetz machte, allerdings zum ganz angemessenen Typus für das Sittlichgute dienen kann, aber mit diesem doch nicht einerlei ist. Eben dieselbe Typik bewahrt auch vor dem Mystizismus der praktischen Vernunft, welche das, was nur zum Symbol diente zum Schema macht, d.h. wirkliche, und doch nicht sinnliche, Anschauungen (eines unsichtbaren Reichs Gottes) der Anwendung der moralischen Begriffe unterlegt und ins Überschwengliche hinausschweift. Dem Gebrauch der moralischen Begriffe ist bloß der Rationalismus der Urteilskraft angemessen, der von der sinnlichen Natur nichts weiter nimmt, als was auch reine Vernunft für sich denken kann, d.h. die Gesetzmäßigkeit, und in die übersinnliche nichts hineinträgt, als was umgekehrt sich durch Handlungen in der Sinnenwelt nach der formalen Regel eines Naturgesetzes überhaupt wirklich darstellen lässt.
Indessen ist die Verwahrung vor dem Empirismus der praktischen Vernunft viel wichtiger und anratungswürdiger, womit der Mystizismus sich doch noch mit der Reinigkeit und Erhabenheit des moralischen Gesetzes zusammen verträgt und außerdem es nicht eben natürlich und der gemeinen Denkart angemessen ist, seine Einbildungskraft bis zu übersinnlichen Anschauungen anzuspannen, mithin auf dieser Seite die Gefahr nicht so allgemein ist; dahingegen der Empirismus die Sittlichkeit in Gesinnungen (worin doch, und nicht bloß in Handlungen, der hohe Wert besteht, den sich die Menschheit durch sie verschaffen kann und soll) mit der Wurzel ausrottet, und ihr ganz etwas anderes, nämlich ein empirisches Interesse, womit die Neigungen überhaupt unter sich Verkehr treiben, statt der Pflicht unterschiebt, überdem auch, eben darum, mit allen Neigungen, die (sie mögen einen Zuschnitt bekommen, welchen sie wollen), wenn sie zur Würde eines obersten praktischen Prinzips erhoben werden, die Menschheit degradieren, und da sie gleichwohl der Sinnesart aller so günstig sind, aus der Ursache weit gefährlicher ist, als alle Schwärmerei, die niemals einen dauernden Zustand vieler Menschen ausmachen kann.
Drittes Hauptstück
Von den Triebfedern der reinen praktischen Vernunft
Das Wesentliche alles sittlichen Werts der Handlungen kommt darauf an, dass das moralische Gesetz unmittelbar den Willen bestimme. Geschieht die Willensbestimmung zwar gemäß dem moralischen Gesetze Gesetz, aber nur vermittelst eines Gefühls, welcher Art es auch sei, das vorausgesetzt werden muss, damit jenes ein hinreichender Bestimmungsgrund des Willens werde, mithin nicht um des Gesetzes willen, so wird die Handlung zwar Legalität, aber nicht Moralität enthalten. Wenn nun unter Triebfeder (elater animi) der subjektive Bestimmungsgrund des Willens eines Wesens verstanden wird, dessen Vernunft nicht, schon vermöge seiner Natur, dem objektiven Gesetz notwendig gemäß ist, so wird erstlich daraus folgen, dass man dem göttlichen Willen gar keine Triebfedern beilegen könne, die Triebfeder des menschlichen Willens aber (und des von jedem erschaffenen vernünftigen Wesen) niemals etwas anderes, als das moralische Gesetz sein könne, mithin der objektive Bestimmungsgrund jederzeit und ganz allein zugleich der subjektiv-hinreichende Bestimmungsgrund der Handlung sein müsse, wenn diese nicht bloß den Buchstaben des Gesetzes, ohne den Geist desselben zu enthalten, erfüllen soll.
Da man also zum Behuf des moralischen Gesetzes, und um ihm Einfluss auf den Willen zu verschaffen, keine anderweitige Triebfeder, dabei die des moralischen Gesetzes entbehrt werden könnte, suchen muss, weil das alles lauter Gleisnerei, ohne Bestand, bewirken würde, und sogar es bedenklich ist, auch nur neben dem moralischen Gesetz noch einige andere Triebfedern (als die des Vorteils) mitwirken zu lassen, so bleibt nichts übrig, als bloß sorgfältig zu bestimmen, auf welche Art das moralische Gesetz Triebfeder werde, und was, indem sie es ist, mit dem menschlichen Begehrungsvermögen, als Wirkung jenes Bestimmungsgrundes auf dasselbe vorgehe. Denn wie ein Gesetz für sich und unmittelbar Bestimmungsgrund des Willens sein könne (welches doch das Wesentliche aller Moralität ist), das ist ein für die menschliche Vernunft unauflösliches Problem und mit dem einerlei, wie ein freier Wille möglich sei. Also werden wir nicht den Grund, woher das moralische Gesetz in sich eine Triebfeder abgebe, sondern was, sofern es eine solche ist, sie im Gemüt wirkt (besser zu sagen, wirken muss), a priori anzuzeigen haben.
Das Wesentliche aller Bestimmung des Willens durchs sittliche Gesetz ist, dass er als freier Wille, mithin nicht bloß ohne Mitwirkung sinnlicher Antriebe, sondern selbst, mit Abweisung aller derselben, und mit Abbruch aller Neigungen, sofern sie jenem Gesetz zuwider sein könnten, bloß durchs Gesetz bestimmt werde. So weit ist also die Wirkung des moralischen Gesetzes als Triebfeder nur negativ, und als solche kann diese Triebfeder a priori erkannt werden. Denn alle Neigung und jeder sinnliche Antrieb ist auf Gefühl gegründet, und die negative Wirkung aufs Gefühl (durch den Abbruch, der den Neigungen geschieht) ist selbst Gefühl. Folglich können wir a priori einsehen, dass das moralische Gesetz als Bestimmungsgrund des Willens dadurch, dass es allen unseren Neigungen Eintrag tut, ein Gefühl bewirken müsse, welches Schmerz genannt werden kann, und hier haben wir nun den ersten, vielleicht auch einzigen Fall, da wir aus Begriffen a priori das Verhältnis eines Erkenntnisses (hier ist es einer reinen praktischen Vernunft) zum Gefühl der Lust oder Unlust bestimmen konnten. Alle Neigungen zusammen (die auch wohl in ein erträgliches System gebracht werden können, und deren Befriedigung alsdann eigene Glückseligkeit heißt) machen die Selbstsucht (solipsimus) aus. Diese ist entweder die der Selbstliebe, eines über alles gehenden Wohlwollens gegen sich selbst (philautia), oder die des Wohlgefallens an sich selbst (arrogantia). Jene heißt besonders Eigenliebe, diese Eigendünkel.
Die reine praktische Vernunft tut der Eigenliebe bloß Abbruch, indem sie solche, als natürlich, und noch vor dem moralischen Gesetz, in uns rege, nur auf die Bedingung der Einstimmung mit diesem Gesetz einschränkt; da sie alsdann vernünftige Selbstliebe genannt wird. Aber den Eigendünkel schlägt sie gar nieder, indem alle Ansprüche der Selbstschätzung, die vor der Übereinstimmung mit dem sittlichen Gesetz vorhergehen, nichtig und ohne alle Befugnis sind, indem eben die Gewissheit einer Gesinnung, die mit diesem Gesetz übereinstimmt, die erste Bedingung alles Werts der Person ist (wie wir bald deutlicher machen werden) und alle Anmaßung vor derselben falsch und gesetzwidrig ist. Nun gehört der Hang zur Selbstschätzung mit zu den Neigungen, denen das moralische Gesetz Abbruch tut, sofern jene bloß auf der Sittlichkeit beruht. Also schlägt das moralische Gesetz den Eigendünkel nieder. Da dieses Gesetz aber doch etwas an sich Positives ist, nämlich die Form einer intellektuellen Kausalität, d.h. der Freiheit, so ist es, indem es im Gegensatze mit dem subjektiven Widerspiel, nämlich den Neigungen in uns, den Eigendünkel schwächt, zugleich ein Gegenstand der Achtung, und, indem es ihn sogar niederschlägt, d.h. demütigt, ein Gegenstand der größten Achtung, mithin auch der Grund eines positiven Gefühls, das nicht empirischen Ursprungs ist, und a priori erkannt wird. Also ist Achtung fürs moralische Gesetz ein Gefühl, welches durch einen intellektuellen Grund gewirkt wird, und dieses Gefühl ist das einzige, welches wir völlig a priori erkennen, und dessen Notwendigkeit wir einsehen können.
Wir haben im vorigen Hauptstück gesehen, dass alles, was sich als Objekt des Willens vor dem moralischen Gesetz darbietet, von den Bestimmungsgründen des Willens, unter dem Namen des unbedingt-Guten, durch dieses Gesetz selbst, als die oberste Bedingung der praktischen Vernunft, ausgeschlossen werde, und dass die bloße praktische Form, die in der Tauglichkeit der Maximen zur allgemeinen Gesetzgebung besteht, zuerst das, was an sich und schlechterdings-gut ist, bestimme, und die Maxime eines reinen Willens gründe, der allein in aller Absicht gut ist. Nun finden wir aber unsere Natur, als sinnliche Wesen so beschaffen, dass die Materie des Begehrungsvermögens (Gegenstände der Neigung, es sei der Hoffnung oder Furcht) sich zuerst aufdrängt, und unser pathologisch bestimmbares Selbst, ob es gleich durch seine Maximen zur allgemeinen Gesetzgebung ganz untauglich ist, dennoch, gleich als ob es unser ganzes Selbst ausmachte, seine Ansprüche vorher und als die ersten und ursprünglichen geltend zu machen bestrebt sei. Man kann diesen Hang, sich selbst nach den subjektiven Bestimmungsgründen seiner Willkür zum objektiven Bestimmungsgrunde des Willens überhaupt zu machen, die Selbstliebe nennen, welche, wenn sie sich gesetzgebend und zum unbedingten praktischen Prinzip macht, Eigendünkel heißen kann.
Nun schließt das moralische Gesetz, welches allein wahrhaftig (nämlich in aller Absicht) objektiv ist, den Einfluss der Selbstliebe auf das oberste praktische Prinzip gänzlich aus, und tut dem Eigendünkel, der die subjektiven Bedingungen des ersteren als Gesetze vorschreibt, unendlichen Abbruch. Was nun unserem Eigendünkel in unserem eigenen Urteil Abbruch tut, das demütigt. Also demütigt das moralische Gesetz unvermeidlich jeden Menschen, indem dieser mit demselben den sinnlichen Hang seiner Natur vergleicht. Dasjenige, dessen Vorstellung als Bestimmungsgrund unseres Willens uns in unserem Selbstbewusstsein demütigt, erweckt, sofern als es positiv und Bestimmungsgrund ist, für sich Achtung. Also ist das moralische Gesetz auch subjektiv ein Grund der Achtung. Da nun alles, was in der Selbstliebe angetroffen wird, zur Neigung gehört, alle Neigung aber auf Gefühlen beruht, mithin, was allen Neigungen insgesamt in der Selbstliebe Abbruch tut, eben dadurch notwendig auf das Gefühl Einfluss hat, so begreifen wir, wie es möglich ist, a priori einzusehen, dass das moralische Gesetz, indem es die Neigungen und den Hang, sie zur obersten praktischen Bedingung zu machen, d.h. die Selbstliebe, von allem Beitritte zur obersten Gesetzgebung ausschließt, eine Wirkung aufs Gefühl ausüben könne, welche einerseits bloß negativ ist, andererseits und zwar in Ansehung des einschränkenden Grundes der reinen praktischen Vernunft positiv ist, und wozu gar keine besondere Art von Gefühlen, unter dem Namen eines praktischen, oder moralischen, als vor dem moralischen Gesetz vorhergehend und ihm zum Grunde liegend, angenommen werden darf.
Die negative Wirkung auf Gefühl (der Unannehmlichkeit) ist, so wie aller Einfluss auf dasselbe, und wie jedes Gefühl überhaupt, pathologisch. Als Wirkung aber vom Bewusstsein des moralischen Gesetzes, folglich in Beziehung auf eine intelligibele Ursache, nämlich das Subjekt der reinen praktischen Vernunft, als oberster Gesetzgeberin, heißt dieses Gefühl eines vernünftigen von Neigungen affizierten Subjekts zwar Demütigung (intellektuelle Verachtung), aber in Beziehung auf den positiven Grund derselben, das Gesetz, zugleich Achtung für dasselbe, für welches Gesetz gar kein Gefühl stattfindet, sondern im Urteile der Vernunft, indem es den Widerstand aus dem Weg schafft, die Wegräumung eines Hindernisses einer positiven Beförderung der Kausalität gleichgeschätzt wird. Darum kann dieses Gefühl nun auch ein Gefühl der Achtung fürs moralische Gesetz, aus beiden Gründen zusammen aber ein moralisches Gefühl genannt werden.
Das moralische Gesetz also, so wie es formaler Bestimmungsgrund der Handlung ist, durch praktische reine Vernunft, so wie es zwar auch materialer, aber nur objektiver Bestimmungsgrund der Gegenstände der Handlung unter dem Namen des Guten und Bösen ist, so ist es auch subjektiver Bestimmungsgrund, d.h. Triebfeder, zu dieser Handlung, indem es auf die Sittlichkeit des Subjekts Einfluss hat, und ein Gefühl bewirkt, welches dem Einfluss des Gesetzes auf den Willen beförderlich ist. Hier geht kein Gefühl im Subjekt vorher, das auf Moralität gestimmt wäre. Denn das ist unmöglich, weil alles Gefühl sinnlich ist; die Triebfeder der sittlichen Gesinnung aber muss von aller sinnlichen Bedingung frei sein. Vielmehr ist das sinnliche Gefühl, was allen unseren Neigungen zum Grunde liegt, zwar die Bedingung derjenigen Empfindung, die wir Achtung nennen, aber die Ursache der Bestimmung desselben liegt in der reinen praktischen Vernunft, und diese Empfindung kann daher, ihres Ursprunges wegen, nicht pathologisch, sondern muss praktisch-gewirkt heißen; indem dadurch, dass die Vorstellung des moralischen Gesetzes der Selbstliebe den Einfluss, und dem Eigendünkel den Wahn benimmt, das Hindernis der reinen praktischen Vernunft vermindert, und die Vorstellung des Vorzuges ihres objektiven Gesetzes vor den Antrieben der Sinnlichkeit, mithin das Gewicht des ersteren relativ (in Ansehung eines durch die letztere affizierten Willens) durch die Wegschaffung des Gegengewichts, im Urteile der Vernunft, hervorgebracht wird.
Und so ist die Achtung fürs Gesetz nicht Triebfeder zur Sittlichkeit, sondern sie ist die Sittlichkeit selbst, subjektiv als Triebfeder betrachtet, indem die reine praktische Vernunft dadurch, dass sie der Selbstliebe, im Gegensatz mit ihr, alle Ansprüche abschlägt, dem Gesetz das jetzt allein Einfluss hat, Ansehen verschafft. Hierbei ist nun zu bemerken, dass, so wie die Achtung eine Wirkung aufs Gefühl, mithin auf die Sinnlichkeit eines vernünftigen Wesens ist, es diese Sinnlichkeit, mithin auch die Endlichkeit solcher Wesen, denen das moralische Gesetz Achtung auferlegt, voraussetze, und dass einem höchsten, oder auch einem von aller Sinnlichkeit freien Wesen, welchem diese also auch kein Hindernis der praktischen Vernunft sein kann, Achtung fürs Gesetz nicht beigelegt werden könne. Dieses Gefühl (unter dem Namen des moralischen) ist also lediglich durch Vernunft bewirkt. Es dient nicht zu Beurteilung der Handlungen oder wohl gar zur Gründung des objektiven Sittengesetzes selbst, sondern bloß zur Triebfeder, um dieses in sich zur Maxime zu machen.
Mit welchem Namen aber könnte man dieses sonderbare Gefühl, welches mit keinem pathologischen in Vergleichung gezogen werden kann, schicklicher belegen?
Es ist so eigentümlicher Art, dass es lediglich der Vernunft, und zwar der praktischen reinen Vernunft, zu Gebote zu stehen scheint. Achtung geht jederzeit nur auf Personen, niemals auf Sachen. Die letzteren können Neigung und, wenn es Tiere sind (z.B. Pferde, Hunde etc.), sogar Liebe oder auch Furcht, wie das Meer, ein Vulkan, ein Raubtier, niemals aber Achtung in uns erwecken. Etwas, was diesem Gefühl schon näher tritt, ist Bewunderung und diese, als Affekt, das Erstaunen, kann auch auf Sachen gehen, z.B. himmelhohe Berge, die Größe, Menge und Weite der Weltkörper, die Stärke und Geschwindigkeit mancher Tiere, usw. Aber alles dieses ist nicht Achtung. Ein Mensch kann mir auch ein Gegenstand der Liebe, der Furcht, oder der Bewunderung, sogar bis zum Erstaunen und doch darum kein Gegenstand der Achtung sein. Seine scherzhafte Laune, sein Mut und Stärke, seine Macht, durch seinen Rang, den er unter anderem hat, können mir dergleichen Empfindungen einflößen, es fehlt aber immer noch an innerer Achtung gegen ihn.
Fontenelle sagt: vor einem Vornehmen bücke ich mich, aber mein Geist bückt sich nicht. Ich kann hinzu setzen, vor einem niedrigen, bürgerlich-gemeinen Mann, an dem ich eine Rechtschaffenheit des Charakters in einem gewissen Maße, als ich mir von mir selbst nicht bewusst bin, wahrnehme, bückt sich mein Geist, ich mag wollen oder nicht, und den Kopf noch so hoch tragen, um ihn meinen Vorrang nicht übersehen zu lassen. Warum das?
Sein Beispiel hält mir ein Gesetz vor, das meinen Eigendünkel niederschlägt, wenn ich es mit meinem Verhalten vergleiche, und dessen Befolgung, mithin die Tunlichkeit desselben, ich durch die Tat bewiesen vor mir sehe. Nun mag ich mir sogar eines gleichen Grades der Rechtschaffenheit bewusst sein, und die Achtung bleibt doch. Denn, da beim Menschen immer alles Gute mangelhaft ist, so schlägt das Gesetz, durch ein Beispiel anschaulich gemacht, doch immer meinen Stolz nieder, wozu der Mann, den ich vor mir sehe, dessen Unlauterkeit, die ihm immer noch anhängen mag, mir nicht so, wie mir die meinige, bekannt ist, der mir also in reinerem Lichte erscheint, einen Maßstab abgibt. Achtung ist ein Tribut, den wir dem Verdienst nicht verweigern können, ob wir mögen wollen oder nicht; wir mögen allenfalls äußerlich damit zurückhalten, so können wir doch nicht verhüten, sie innerlich zu empfinden.
Die Achtung ist so wenig ein Gefühl der Lust, dass man sich ihr in Ansehung eines Menschen nur ungern überlässt. Man sucht etwas ausfindig zu machen, was uns die Last derselben erleichtern könne, irgendeinen Tadel, um uns wegen der Demütigung, die uns durch ein solches Beispiel widerfährt, schadlos zu halten. Selbst Verstorbene sind, vornehmlich wenn ihr Beispiel unnachahmlich scheint, vor dieser Kritik nicht immer gesichert. Sogar das moralische Gesetz selbst, in seiner feierlichen Majestät, ist diesem Bestreben, sich der Achtung dagegen zu erwehren, ausgesetzt. Meint man wohl, dass es einer anderen Ursache zuzuschreiben sei, weswegen man es gern zu unserer vertraulichen Neigung herabwürdigen möchte, und sich aus anderen Ursachen alles so bemühe, um es zur beliebten Vorschrift unseres eigenen wohlverstandenen Vorteils zu machen, als dass man der abschreckenden Achtung, die uns unsere eigene Unwürdigkeit so streng vorhält, loswerden möge?
Gleichwohl ist darin doch auch wiederum so wenig Unlust, dass, wenn man einmal den Eigendünkel abgelegt, und jener Achtung praktischen Einfluss gestattet hat, man sich wiederum an der Herrlichkeit dieses Gesetzes nicht satt sehen kann, und die Seele sich in dem Maße selbst zu erheben glaubt, als sie das heilige Gesetz über sich und ihre gebrechliche Natur erhaben sieht. Zwar können große Talente und eine ihnen proportionierte Tätigkeit auch Achtung, oder ein mit derselben analogisches Gefühl, bewirken, es ist auch ganz anständig, es ihnen zu widmen, und da scheint es, als ob Bewunderung mit jener Empfindung einerlei sei. Allein, wenn man näher zusieht, so wird man bemerken, dass, da es immer ungewiss bleibt, wie viel das angeborene Talent und wie viel Kultur durch eigenen Fleiß an der Geschicklichkeit teilhabe, so stellt uns die Vernunft die letztere mutmaßlich als Frucht der Kultur, mithin als Verdienst vor, welches unseren Eigendünkel merklich herabstimmt, und uns darüber entweder Vorwürfe macht, oder uns die Befolgung eines solchen Beispiels, in der Art, wie es uns angemessen ist, auferlegt. Sie ist also nicht bloße Bewunderung, diese Achtung, die wir einer solchen Person (eigentlich dem Gesetz, was uns sein Beispiel vorhält) beweisen; welches sich auch dadurch bestätigt, dass der gemeine Haufe der Liebhaber, wenn er das Schlechte des Charakters eines solchen Mannes (wie etwa Voltaire) sonst woher erkundigt zu haben glaubt, alle Achtung gegen ihn aufgibt, der wahre Gelehrte aber sie noch immer wenigstens im Gesichtspunkte seiner Talente fühlt, weil er selbst in einem Geschäfte und Berufe verwickelt ist, welches die Nachahmung desselben ihm gewissermaßen zum Gesetz macht.
Achtung fürs moralische Gesetz ist also die einzige und zugleich unbezweifelte moralische Triebfeder, so wie dieses Gefühl auch auf kein Objekt anders, als lediglich aus diesem Grunde gerichtet ist. Zuerst bestimmt das moralische Gesetz objektiv und unmittelbar den Willen im Urteile der Vernunft; Freiheit, deren Kausalität bloß durchs Gesetz bestimmbar ist, besteht aber eben darin, dass sie alle Neigungen, mithin die Schätzung der Person selbst auf die Bedingung der Befolgung ihres reinen Gesetzes einschränkt. Diese Einschränkung tut nun eine Wirkung aufs Gefühl, und bringt Empfindung der Unlust hervor, die aus dem moralischen Gesetz a priori erkannt werden kann. Da sie aber bloß sofern eine negative Wirkung ist, die, als aus dem Einfluss einer reinen praktischen Vernunft entsprungen, vornehmlich der Tätigkeit des Subjekts, sofern Neigungen die Bestimmungsgründe desselben sind, mithin der Meinung seines persönlichen Werts Abbruch tut (der ohne Einstimmung mit dem moralischen Gesetz auf nichts herabgesetzt wird), so ist die Wirkung dieses Gesetzes aufs Gefühl bloß Demütigung, welches wir also zwar a priori einsehen, aber an ihr nicht die Kraft des reinen praktischen Gesetzes als Triebfeder, sondern nur den Widerstand gegen Triebfedern der Sinnlichkeit erkennen können.
Weil aber dasselbe Gesetz doch objektiv, d.h. in der Vorstellung der reinen Vernunft, ein unmittelbarer Bestimmungsgrund des Willens ist, folglich diese Demütigung nur relativ auf die Reinigkeit des Gesetzes stattfindet, so ist die Herabsetzung der Ansprüche der moralischen Selbstschätzung, d.h. die Demütigung auf der sinnlichen Seite, eine Erhebung der moralischen, d.h. der praktischen Schätzung des Gesetzes selbst, auf der intellektuellen, mit einem Worte Achtung fürs Gesetz, also auch ein, seiner intellektuellen Ursache nach, positives Gefühl, das a priori erkannt wird. Denn eine jede Verminderung der Hindernisse einer Tätigkeit ist Beförderung dieser Tätigkeit selbst. Die Anerkennung des moralischen Gesetzes aber ist das Bewusstsein einer Tätigkeit der praktischen Vernunft aus objektiven Gründen, die bloß darum nicht ihre Wirkung in Handlungen äußert, weil subjektive Ursachen (pathologische) sie hindern. Also muss die Achtung fürs moralische Gesetz auch als positive aber indirekte Wirkung desselben aufs Gefühl, sofern jenes den hindernden Einfluss der Neigungen durch Demütigung des Eigendünkels schwächt, mithin als subjektiver Grund der Tätigkeit, d.h. als Triebfeder zu Befolgung desselben, und als Grund zu Maximen eines ihm gemäßen Lebenswandels angesehen werden.
Aus dem Begriff einer Triebfeder entspringt der eines Interesses, welches niemals einem Wesen, als was Vernunft hat, beigelegt wird, und eine Triebfeder des Willens bedeutet, sofern sie durch Vernunft vorgestellt wird. Da das Gesetz selbst in einem moralisch-guten Willen die Triebfeder sein muss, so ist das moralische Interesse ein reines sinnenfreies Interesse der bloßen praktischen Vernunft. Auf dem Begriffe eines Interesses gründet sich auch der einer Maxime. Diese ist also nur alsdann moralisch echt, wenn sie auf dem bloßen Interesse, das man an der Befolgung des Gesetzes nimmt, beruht.
Alle drei Begriffe aber, der einer Triebfeder, eines Interesses und einer Maxime, können nur auf endliche Wesen angewandt werden. Denn sie setzen insgesamt eine Eingeschränktheit der Natur eines Wesens voraus, da die subjektive Beschaffenheit seiner Willkür mit dem objektiven Gesetze einer praktischen Vernunft nicht von selbst übereinstimmt; ein Bedürfnis, irgendwodurch zur Tätigkeit angetrieben zu werden, weil ein inneres Hindernis derselben entgegensteht. Auf den göttlichen Willen können sie also nicht angewandt werden.
Es liegt so etwas Besonderes in der grenzenlosen Hochschätzung des reinen, von allem Vorteil entblößten, moralischen Gesetzes, so wie es praktische Vernunft uns zur Befolgung vorstellt, deren Stimme auch den kühnsten Frevler zittern macht, und ihn nötigt, sich vor seinem Anblick zu verbergen, dass man sich nicht wundern darf, diesen Einfluss einer bloß intellektuellen Idee aufs Gefühl für spekulative Vernunft unergründlich zu finden, und sich damit begnügen zu müssen, dass man a priori doch noch so viel einsehen kann, ein solches Gefühl sei unzertrennlich mit der Vorstellung des moralischen Gesetzes in jedem endlichen vernünftigen Wesen verbunden. Wäre dieses Gefühl der Achtung pathologisch und also ein auf dem inneren Sinne gegründetes Gefühl der Lust, so würde es vergeblich sein, eine Verbindung derselben mit irgendeiner Idee a priori zu entdecken.
Nun aber ist ein Gefühl, was bloß aufs Praktische geht, und zwar der Vorstellung eines Gesetzes lediglich seiner Form nach, nicht irgend eines Objekts desselben wegen, anhängt, mithin weder zum Vergnügen, noch zum Schmerze gerechnet werden kann, und dennoch ein Interesse an der Befolgung desselben hervorbringt, welches wir das moralische nennen; wie denn auch die Fähigkeit, ein solches Interesse am Gesetz zu nehmen (oder die Achtung fürs moralische Gesetz selbst) eigentlich das moralische Gefühl ist.
Das Bewusstsein einer freien Unterwerfung des Willens unter das Gesetz, doch als mit einem unvermeidlichen Zwange, der allen Neigungen, aber nur durch eigene Vernunft angetan wird, verbunden, ist nun die Achtung fürs Gesetz. Das Gesetz, was diese Achtung fordert und auch einflößt, ist, wie man sieht, kein anderes, als das moralische (denn kein anderes schließt alle Neigungen von der Unmittelbarkeit ihres Einflusses auf den Willen aus). Die Handlung, die nach diesem Gesetz, mit Ausschließung aller Bestimmungsgründe aus Neigung, objektiv praktisch ist, heißt Pflicht, welche, um dieser Ausschließung willen, in ihrem Begriffe praktische Nötigung, d.h. Bestimmung zu Handlungen, so ungerne, wie sie auch geschehen mögen, enthält.
Das Gefühl, das aus dem Bewusstsein dieser Nötigung entspringt, ist nicht pathologisch, als ein solches, was von einem Gegenstande der Sinne gewirkt würde, sondern allein praktisch, d.h. durch eine vorhergehende (objektive) Willensbestimmung und Kausalität der Vernunft, möglich. Es enthält also, als Unterwerfung unter ein Gesetz, d.h. als Gebot (welches für das sinnlich-affizierte Subjekt Zwang ankündigt), keine Lust, sondern, sofern, vielmehr Unlust an der Handlung in sich. Dagegen aber, da dieser Zwang bloß durch Gesetzgebung der eigenen Vernunft ausgeübt wird, enthält es auch Erhebung, und die subjektive Wirkung aufs Gefühl, sofern davon reine praktische Vernunft die alleinige Ursache ist, kann also bloß Selbstbilligung in Ansehung der letzteren heißen, indem man sich dazu, ohne alles Interesse, bloß durchs Gesetz bestimmt erkennt, und sich nunmehro eines ganz anderen, dadurch subjektiv hervorgebrachten, Interesse, welches rein praktisch und frei ist, bewusst wird, welches an einer pflichtmäßigen Handlung zu nehmen nicht etwa eine Neigung anrätig ist, sondern die Vernunft durchs praktische Gesetz schlechthin gebietet und auch wirklich hervorbringt, darum aber einen ganz eigentümlichen Namen, nämlich den der Achtung, führt.
Der Begriff der Pflicht fordert also an der Handlung, objektiv, Übereinstimmung mit dem Gesetz, an der Maxime derselben aber, subjektiv, Achtung fürs Gesetz, als die alleinige Bestimmungsart des Willens durch dasselbe. Und darauf beruht der Unterschied zwischen dem Bewusstsein, pflichtmäßig und aus Pflicht, d.h. aus Achtung fürs Gesetz, gehandelt zu haben, davon das erstere (die Legalität) auch möglich ist, wenn Neigungen bloß die Bestimmungsgründe des Willens gewesen wären, das zweite aber (die Moralität), der moralische Wert, lediglich darin gesetzt werden muss, dass die Handlung aus Pflicht, d.h. bloß um des Gesetzes willen geschehe.
Es ist von der größten Wichtigkeit in allen moralischen Beurteilungen, auf das subjektive Prinzip aller Maximen mit der äußersten Genauigkeit Acht zu haben, damit alle Moralität der Handlungen in der Notwendigkeit derselben aus Pflicht und aus Achtung fürs Gesetz, nicht aus Liebe und Zuneigung zu dem, was die Handlungen hervorbringen sollen, gesetzt werde. Für Menschen und alle erschaffenen vernünftigen Wesen ist die moralische Notwendigkeit Nötigung, d.h. Verbindlichkeit, und jede darauf gegründete Handlung als Pflicht, nicht aber als eine uns von selbst schon beliebte, oder beliebt werden könnende Verfahrungsart vorzustellen.
Gleich als ob wir es dahin jemals bringen könnten, dass ohne Achtung fürs Gesetz, welche mit Furcht oder wenigstens Besorgnis vor Übertretung verbunden ist, wir, wie die über alle Abhängigkeit erhabene Gottheit, von selbst, gleichsam durch eine uns zur Natur gewordene, niemals zu verrückende Übereinstimmung des Willens mit dem reinen Sittengesetz (welches also, da wir niemals versucht werden können, ihm untreu zu werden, wohl endlich gar aufhören könnte, für uns Gebot zu sein), jemals in den Besitz einer Heiligkeit des Willens kommen könnten. Das moralische Gesetz ist nämlich für den Willen eines allervollkommensten Wesens ein Gesetz der Heiligkeit, für den Willen jedes endlichen vernünftigen Wesens aber ein Gesetz der Pflicht, der moralischen Nötigung und der Bestimmung der Handlungen desselben durch Achtung für dieses Gesetz und aus Ehrfurcht für seine Pflicht.
Ein anderes subjektives Prinzip muss zur Triebfeder nicht angenommen werden, denn sonst kann zwar die Handlung, wie das Gesetz sie vorschreibt, ausfallen, aber, da sie zwar pflichtmäßig ist, aber nicht aus Pflicht geschieht, so ist die Gesinnung dazu nicht moralisch, auf die es doch in dieser Gesetzgebung eigentlich ankommt.
Es ist sehr schön, aus Liebe zu Menschen und teilnehmendem Wohlwollen ihnen Gutes zu tun, oder aus Liebe zur Ordnung gerecht zu sein, aber das ist noch nicht die echte moralische Maxime unseres Verhaltens, die unserem Standpunkt, unter vernünftigen Wesen, als Menschen, angemessen ist, wenn wir uns anmaßen, gleichsam als Volontäre, uns mit stolzer Einbildung über den Gedanken von Pflicht wegzusetzen, und uns, als vom Gebote unabhängig, bloß aus eigener Lust das tun zu wollen, wozu für uns kein Gebot nötig wäre.
Wir stehen unter einer Disziplin der Vernunft, und müssen in allen unseren Maximen der Unterwürfigkeit unter derselben nicht vergessen, ihr nichts zu entziehen, oder dem Ansehen des Gesetzes (ob es gleich unsere eigene Vernunft gibt) durch eigenliebigen Wahn dadurch etwas abkürzen, dass wir den Bestimmungsgrund unseres Willens, wenn gleich dem Gesetz gemäß, doch worin anders, als im Gesetz selbst, und in der Achtung für dieses Gesetz setzten. Pflicht und Schuldigkeit sind die Benennungen, die wir allein unserem Verhältnis zum moralischen Gesetz geben müssen. Wir sind zwar gesetzgebende Glieder eines durch Freiheit möglichen, durch praktische Vernunft uns zur Achtung vorgestellten Reichs der Sitten, aber doch zugleich Untertanen, nicht das Oberhaupt desselben, und die Verkennung unserer niederen Stufe als Geschöpfe und Weigerung des Eigendünkels gegen das Ansehen des heiligen Gesetzes, ist schon eine Abtrünnigkeit von demselben, dem Geiste nach, wenngleich der Buchstabe desselben erfüllt würde. Hiermit stimmt aber die Möglichkeit eines solchen Gebots, als, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst, ganz wohl zusammen.
Denn es fordert doch, als Gebot, Achtung für ein Gesetz, das Liebe befiehlt, und überlässt es nicht der beliebigen Wahl, sich diese zum Prinzip zu machen. Aber Liebe zu Gott als Neigung (pathologische Liebe) ist unmöglich; denn er ist kein Gegenstand der Sinne. Eben dieselbe gegen Menschen ist zwar möglich, kann aber nicht geboten werden; denn es steht in keines Menschen Vermögen, jemanden bloß auf Befehl zu lieben. Also ist es bloß die praktische Liebe, die in jenem Kern aller Gesetze verstanden wird. Gott lieben, heißt in dieser Bedeutung, seine Gebote gerne tun; den Nächsten lieben, heißt, alle Pflicht gegen ihn gerne ausüben. Das Gebot aber, das dieses zur Regel macht, kann auch nicht diese Gesinnung in pflichtmäßigen Handlungen zu haben, sondern bloß danach zu streben gebieten. Denn ein Gebot, dass man etwas gerne tun soll, ist in sich widersprechend, weil, wenn wir, was uns zu tun obliege, schon von selbst wissen, wenn wir uns überdem auch bewusst wären, es gerne zu tun, ein Gebot darüber ganz unnötig, und, tun wir es zwar, aber eben nicht gerne, sondern nur aus Achtung fürs Gesetz, ein Gebot, welches diese Achtung eben zur Triebfeder der Maxime macht, gerade der gebotenen Gesinnung zuwider wirken würde. Jenes Gesetz aller Gesetze stellt also, wie alle moralische Vorschrift des Evangelii, die sittliche Gesinnung in ihrer ganzen Vollkommenheit dar, so wie sie als ein Ideal der Heiligkeit von keinem Geschöpf erreichbar, dennoch das Urbild ist, welchem wir uns zu nähern (näheren), und, in einem ununterbrochenen, aber unendlichen Progressus, gleich zu werden streben sollen.
Könnte nämlich ein vernünftiges Geschöpf jemals dahin kommen, alle moralischen Gesetze völlig gerne zu tun, so würde das so viel bedeuten, als, es fände sich in ihm auch nicht einmal die Möglichkeit einer Begierde, die ihn zur Abweichung von ihnen reizte; denn die Überwindung einer solchen kostet dem Subjekt immer Aufopferung, bedarf also Selbstzwang, d.h. innere Nötigung zu dem, was man nicht ganz gern tut. Zu dieser Stufe der moralischen Gesinnung aber kann es ein Geschöpf niemals bringen. Denn da es ein Geschöpf, mithin in Ansehung dessen, was er zur gänzlichen Zufriedenheit mit seinem Zustande fordert, immer abhängig ist, so kann es niemals von Begierden und Neigungen ganz frei sein, die, weil sie auf physischen Ursachen beruhen, mit dem moralischen Gesetz, das ganz andere Quellen hat, nicht von selbst stimmen, mithin es jederzeit notwendig machen, in Rücksicht auf dieselbe, die Gesinnung seiner Maximen auf moralische Nötigung, nicht auf bereitwillige Ergebenheit, sondern auf Achtung, welche die Befolgung des Gesetzes, obgleich sie ungerne geschähe, fordert, nicht auf Liebe, die keine innere Weigerung des Willens gegen das Gesetz besorgt, zu gründen, gleichwohl aber diese letztere, nämlich die bloße Liebe zum Gesetz (da es alsdann aufhören würde, Gebot zu sein, und Moralität, die nun subjektiv in Heiligkeit überginge, aufhören würde, Tugend zu sein) sich zum beständigen, obgleich unerreichbaren Ziel seiner Bestrebung zu machen. Denn an dem, was wir hochschätzen, aber doch (wegen des Bewusstseins unserer Schwächen) scheuen, verwandelt sich, durch die mehrere Leichtigkeit, ihm Genüge zu tun, die ehrfurchtsvolle Scheu in Zuneigung, und Achtung in Liebe, wenigstens würde es die Vollendung einer dem Gesetz gewidmeten Gesinnung sein, wenn es jemals einem Geschöpf möglich wäre, sie zu erreichen.
Diese Betrachtung ist hier nicht so wohl dahin abgezweckt, das angeführte evangelische Gebot auf deutliche Begriffe zu bringen, um der Religionsschwärmerei in Ansehung der Liebe Gottes, sondern die sittliche Gesinnung, auch unmittelbar in Ansehung der Pflichten gegen Menschen, genau zu bestimmen, und einer bloß moralischen Schwärmerei, welche viel Köpfe ansteckt, zu steuern, oder, wo möglich, vorzubeugen. Die sittliche Stufe, worauf der Mensch (aller unserer Einsicht nach auch jedes vernünftige Geschöpf) steht, ist Achtung fürs moralische Gesetz. Die Gesinnung, die ihm, dieses zu befolgen, obliegt, ist, es aus Pflicht, nicht aus freiwilliger Zuneigung und auch allenfalls unbefohlener von selbst gern unternommener Bestrebung zu befolgen, und sein moralischer Zustand, darin er jedesmal sein kann, ist Tugend, d.h. moralische Gesinnung im Kampf, und nicht Heiligkeit im vermeinten Besitz einer völligen Reinigkeit der Gesinnungen des Willens.
Es ist lauter moralische Schwärmerei und Steigerung des Eigendünkels, wozu man die Gemüter durch Aufmunterung zu Handlungen, als edler, erhabener und großmütiger stimmt, dadurch man sie in den Wahn versetzt, als wäre es nicht Pflicht, d.h. Achtung fürs Gesetz, dessen Joch (das gleichwohl, weil es uns Vernunft selbst auferlegt, sanft ist) sie, wenngleich ungern, tragen müssten, was den Bestimmungsgrund ihrer Handlungen ausmachte, und welches sie immer noch demütigt, indem sie es befolgen (ihm gehorchen), sondern als ob jene Handlungen nicht aus Pflicht, sondern als barer Verdienst von ihnen erwartet würde. Denn nicht allein, dass sie durch Nachahmung solcher Taten, nämlich aus solchem Prinzip, nicht im mindesten dem Geiste des Gesetzes ein Genüge getan hätten, welcher in der dem Gesetz sich unterwerfenden Gesinnung, nicht in der Gesetzmäßigkeit der Handlung (das Prinzip möge sein, welches auch wolle), besteht, und die Triebfeder pathologisch (in der Sympathie oder auch Philautie), nicht moralisch (im Gesetz) setzen, so bringen sie auf diese Art eine windige, überfliegende, phantastische Denkungsart hervor, sich mit einer freiwilligen Gutartigkeit ihres Gemüts, das weder Sporns noch Zügel bedürfe, für welches gar nicht einmal ein Gebot nötig sei, zu schmeicheln, und darüber ihrer Schuldigkeit, an welche sie doch eher denken sollten, als an Verdienst, zu vergessen.
Es lassen sich wohl Handlungen anderer, die mit großer Aufopferung, und zwar bloß um der Pflicht willen, geschehen sind, unter dem Namen edler und erhabener Taten preisen, und doch auch nur sofern Spuren da sind, welche vermuten lassen, dass sie ganz aus Achtung für seine Pflicht, nicht aus Herzensaufwallungen geschehen sind. Will man jemanden aber sie als Beispiele der Nachfolge vorstellen, so muss durchaus die Achtung für Pflicht (als das einzige echte, moralische Gefühl) zur Triebfeder gebraucht werden, diese ernste, heilige Vorschrift, die es nicht unserer eitlen Selbstliebe überlässt, mit pathologischen Antrieben (sofern sie der Moralität analogisch sind) zu tändeln, und uns auf verdienstlichen Wert was zu Gute zu tun. Wenn wir nur wohl nachsuchen, so werden wir zu allen Handlungen, die anpreisungswürdig sind, schon ein Gesetz der Pflicht finden, welches gebietet und nicht auf unser Belieben ankommen lässt, was unserem Hange gefällig sein möchte. Das ist die einzige Darstellungsart, welche die Seele moralisch bildet, weil sie allein fester und genau bestimmter Grundsätze fähig ist.
Wenn Schwärmerei in der allergemeinsten Bedeutung eine nach Grundsätzen unternommene Überschreitung der Grenzen der menschlichen Vernunft ist, so ist moralische Schwärmerei diese Überschreitung der Grenzen, die die praktische reine Vernunft der Menschheit setzt, dadurch sie verbietet, den subjektiven Bestimmungsgrund pflichtmäßiger Handlungen, d.h. die moralische Triebfeder derselben, irgend worin anders, als im Gesetz selbst, und die Gesinnung, die dadurch in die Maximen gebracht wird, irgend anderwärts, als in der Achtung für dieses Gesetz, zu setzen, mithin den alle Arroganz sowohl als eitle Philautie niederschlagenden Gedanken von Pflicht zum obersten Lebensprinzip aller Moralität im Menschen zu machen gebietet.
Wenn dem also ist, so haben nicht allein Romanschreiber, oder empfindelnde Erzieher (ob sie gleich noch so sehr wider Empfindelei eifern), sondern bisweilen selbst Philosophen, ja die strengsten unter allen, die Stoiker, moralische Schwärmerei, statt nüchterner, aber weiser Disziplin der Sitten, eingeführt, wenngleich die Schwärmerei der letzteren mehr heroisch, der ersteren von schaler und schmelzender Beschaffenheit war, und man kann es, ohne zu heucheln, der moralischen Lehre des Evangelii mit aller Wahrheit nachsagen, dass es zuerst, durch die Reinigkeit des moralischen Prinzips, zugleich aber durch die Angemessenheit desselben mit den Schranken endlicher Wesen, alles Wohlverhalten des Menschen der Zucht einer ihnen vor Augen gelegten Pflicht, die sie nicht unter moralischen, geträumten Vollkommenheiten schwärmen läßt, unterworfen und dem Eigendünkel sowohl als der Eigenliebe, die beide gerne ihre Grenzen verkennen, Schranken der Demut (d.h. der Selbsterkenntnis) gesetzt habe.
Pflicht! Du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was Einschmeichelung bei sich führt, in dir fasst, sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nichts drohst, was natürliche Abneigung im Gemüt erregte und schreckte, um den Willen zu bewegen, sondern bloß ein Gesetz aufstellst, welches von selbst im Gemüt Eingang findet, und doch sich selbst wider Willen Verehrung (wenn gleich nicht immer Befolgung) erwirbt, vor dem alle Neigungen verstummen, wenn sie gleich in Geheim ihm entgegen wirken, welches ist der deiner würdige Ursprung, und wo findet man die Wurzel deiner edlen Abkunft, welche alle Verwandtschaft mit Neigungen stolz ausschlägt, und von welcher Wurzel abzustammen die unnachlassliche Bedingung desjenigen Werts ist, den sich Menschen allein selbst geben können?
Es kann nichts Minderes sein, als was den Menschen über sich selbst (als einen Teil der Sinnenwelt) erhebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge knüpft, die nur der Verstand denken kann, und die zugleich die ganze Sinnenwelt, mit ihr das empirisch-bestimmbare Dasein des Menschen in der Zeit und das Ganze aller Zwecke (welches allein solchen unbedingten praktischen Gesetzen, als das moralische, angemessen ist) unter sich hat. Es ist nichts anderes als die Persönlichkeit, d.h. die Freiheit und Unabhängigkeit von dem Mechanismus der ganzen Natur, doch zugleich als ein Vermögen eines Wesens betrachtet, welches eigentümlichen, nämlich von seiner eigenen Vernunft gegebenen reinen praktischen Gesetzen, die Person also, als zur Sinnenwelt gehörig, ihrer eigenen Persönlichkeit unterworfen ist, sofern sie zugleich zur intelligibelen Welt gehört; da es denn nicht zu verwundern ist, wenn der Mensch, als zu beiden Welten gehörig, sein eigenes Wesen, in Beziehung auf seine zweite und höchste Bestimmung, nicht anders, als mit Verehrung und die Gesetze derselben mit der höchsten Achtung betrachten muss.
Auf diesen Ursprung gründen sich nun manche Ausdrücke, welche den Wert der Gegenstände nach moralischen Ideen bezeichnen. Das moralische Gesetz ist heilig (unverletzlich). Der Mensch ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in seiner Person muss ihm heilig sein. In der ganzen Schöpfung kann alles, was man will, und worüber man etwas vermag, auch bloß als Mittel gebraucht werden; nur der Mensch, und mit ihm jedes vernünftige Geschöpf, ist Zweck an sich selbst. Er ist nämlich das Subjekt des moralischen Gesetzes, welches heilig ist, vermöge der Autonomie seiner Freiheit. Eben um dieser willen ist jeder Wille, selbst jeder Person ihr eigener, auf sie selbst gerichteter Wille, auf die Bedingung der Einstimmung mit der Autonomie des vernünftigen Wesens eingeschränkt, es nämlich keiner Absicht zu unterwerfen, die nicht nach einem Gesetz, welches aus dem Willen des leidenden Subjekts selbst entspringen könnte, möglich ist; also dieses niemals bloß als Mittel, sondern zugleich selbst als Zweck zu gebrauchen. Diese Bedingung legen wir mit Recht sogar dem göttlichen Willen, in Ansehung der vernünftigen Wesen in der Welt, als seiner Geschöpfe, bei, indem sie auf der Persönlichkeit derselben beruht, dadurch allein sie Zwecke an sich selbst sind.
Diese Achtung erweckende Idee der Persönlichkeit, welche uns die Erhabenheit unserer Natur (ihrer Bestimmung nach) vor Augen stellt, indem sie uns zugleich den Mangel der Angemessenheit unseres Verhaltens in Ansehung derselben bemerken lässt, und dadurch den Eigendünkel niederschlägt, ist selbst der gemeinsten Menschenvernunft natürlich und leicht bemerklich. Hat nicht jeder auch nur mittelmäßig ehrliche Mann bisweilen gefunden, dass er eine sonst unschädliche Lüge, dadurch er sich entweder selbst aus einem verdrießlichen Handel ziehen, oder wohl gar einem geliebten und verdienstvollen Freunde Nutzen schaffen konnte, bloß darum unterließ, um sich in Geheim in seinen eigenen Augen nicht verachten zu dürfen? Hält nicht einen rechtschaffenen Mann im größten Unglücke des Lebens, das er vermeiden konnte, wenn er sich nur hätte über die Pflicht wegsetzen können, noch das Bewusstsein aufrecht, dass er die Menschheit in seiner Person doch in ihrer Würde erhalten und geehrt habe, dass er sich nicht vor sich selbst zu schämen und den inneren Anblick der Selbstprüfung zu scheuen Ursache habe? Dieser Trost ist nicht Glückseligkeit, auch nicht der mindeste Teil derselben. Denn niemand wird sich die Gelegenheit dazu, auch vielleicht nicht einmal ein Leben in solchen Umständen wünschen. Aber er lebt, und kann es nicht erdulden, in seinen eigenen Augen des Lebens unwürdig zu sein.
Diese innere Beruhigung ist also bloß negativ, in Ansehung alles dessen, was das Leben angenehm machen mag; nämlich sie ist die Abhaltung der Gefahr, im persönlichen Wert zu sinken, nachdem der seines Zustandes von ihm schon gänzlich aufgegeben worden ist. Sie ist die Wirkung von einer Achtung für etwas ganz anderes, als das Leben, womit in Vergleichung und Entgegensetzung das Leben vielmehr, mit aller seiner Annehmlichkeit, gar keinen Wert hat. Er lebt nur noch aus Pflicht, nicht weil er am Leben den mindesten Geschmack findet. So ist die echte Triebfeder der reinen praktischen Vernunft beschaffen; sie ist keine andere, als das reine moralische Gesetz selber, sofern es uns die Erhabenheit unserer eigenen übersinnlichen Existenz spüren läßt, und subjektiv, in Menschen, die sich zugleich ihres sinnlichen Daseins und der damit verbundenen Abhängigkeit von ihrer sofern sehr pathologisch affizierten Natur bewusst sind, Achtung für ihre höhere Bestimmung wirkt.
Nun lassen sich mit dieser Triebfeder gar wohl so viele Reize und Annehmlichkeiten des Lebens verbinden, dass auch um dieser willen allein schon die klügste Wahl eines vernünftigen und über das größte Wohl des Lebens nachdenkenden Epikureers sich für das sittliche Wohlverhalten erklären würde, und es kann auch ratsam sein, diese Aussicht auf einen fröhlichen Genuss des Lebens mit jener obersten und schon für sich allein hinlänglich-bestimmenden Bewegursache zu verbinden; aber nur um den Anlockungen, die das Laster auf der Gegenseite vorzuspiegeln nicht ermangelt, das Gegengewicht zu halten, nicht um hierin die eigentliche bewegende Kraft, auch nicht dem mindesten Teile nach, zu setzen, wenn von Pflicht die Rede ist. Denn das würde so viel sein, als die moralische Gesinnung in ihrer Quelle verunreinigen will. Die Ehrwürdigkeit der Pflicht hat nichts mit Lebensgenuss zu schaffen; sie hat ihr eigentümliches Gesetz, auch ihr eigentümliches Gericht, und wenn man auch beide noch so sehr zusammenschütteln wollte, um sie vermischt, gleichsam als Arzeneimittel, der kranken Seele zuzureichen, so scheiden sie sich doch alsbald von selbst, und, tun sie es nicht, so wirkt das erste gar nicht, wenn aber auch das physische Leben hierbei einige Kraft gewönne, so würde doch das moralische ohne Rettung dahin schwinden.
Kritische Beleuchtung der Analytik der reinen praktischen Vernunft
Ich verstehe unter der kritischen Beleuchtung einer Wissenschaft, oder eines Abschnitts derselben, der für sich ein System ausmacht, die Untersuchung und Rechtfertigung, warum sie gerade diese und keine andere systematische Form haben müsse, wenn man sie mit einem anderen System vergleicht, das ein ähnliches Erkenntnisvermögen zum Grunde hat. Nun hat praktische Vernunft mit der spekulativen sofern einerlei Erkenntnisvermögen zum Grunde, als beide reine Vernunft sind. Also wird der Unterschied der systematischen Form der einen, von der anderen, durch Vergleichung beider bestimmt und Grund davon angegeben werden müssen.
Die Analytik der reinen theoretischen Vernunft hatte es mit dem Erkenntnisse der Gegenstände, die dem Verstande gegeben werden mögen, zu tun, und musste also von der Anschauung, mithin (weil diese jederzeit sinnlich ist) von der Sinnlichkeit anfangen, von da aber allererst zu Begriffen (der Gegenstände dieser Anschauung) fortschreiten, und durfte, nur nach beider Voranschickung, mit Grundsätzen endigen. Dagegen, weil praktische Vernunft es nicht mit Gegenständen, sie zu erkennen, sondern mit ihrem eigenen Vermögen, jene (der Erkenntnis derselben gemäß) wirklich zu machen, d.h. es mit einem Willen zu tun hat, welcher eine Kausalität ist, sofern Vernunft den Bestimmungsgrund derselben enthält, da sie folglich kein Objekt der Anschauung, sondern (weil der Begriff der Kausalität jederzeit die Beziehung auf ein Gesetz enthält, welches die Existenz des Mannigfaltigen im Verhältnis zueinander bestimmt), als praktische Vernunft, nur ein Gesetz derselben anzugeben hat, so muss eine Kritik der Analytik derselben, sofern sie eine praktische Vernunft sein soll (welches die eigentliche Aufgabe ist), von der Möglichkeit praktischer Grundsätze a priori anfangen. Von da konnte sie allein zu Begriffen der Gegenstände einer praktischen Vernunft, nämlich denen des schlechthin-Guten und Bösen fortgehen, um sie jenen Grundsätzen gemäß allererst zu geben (denn diese sind vor jenen Prinzipien als Gutes und Böses durch gar kein Erkenntnisvermögen zu geben möglich), und nur alsdann konnte allererst das letzte Hauptstück, nämlich das von dem Verhältnis der reinen praktischen Vernunft zur Sinnlichkeit und ihrem notwendigen, a priori zu erkennenden Einfluss auf dieselbe, d.h. vom moralischen Gefühl, den Teil beschließen.
So teilte denn die Analytik der praktischen reinen Vernunft ganz analogisch mit der theoretischen den ganzen Umfang aller Bedingungen ihres Gebrauchs, aber in umgekehrter Ordnung. Die Analytik der theoretischen reinen Vernunft wurde in transzendentale Ästhetik und transzendentale Logik eingeteilt, die der praktischen umgekehrt in Logik und Ästhetik der reinen praktischen Vernunft (wenn es mir erlaubt ist, diese sonst gar nicht angemessene Benennungen, bloß der Analogie wegen, hier zu gebrauchen), die Logik wiederum dort in die Analytik der Begriffe und die der Grundsätze, hier in die der Grundsätze und Begriffe. Die Ästhetik hatte dort noch zwei Teile, wegen der doppelten Art einer sinnlichen Anschauung; hier wird die Sinnlichkeit gar nicht als Anschauungsfähigkeit, sondern bloß als Gefühl (das ein subjektiver Grund des Begehrens sein kann) betrachtet, und in Ansehung dessen gestattet die reine praktische Vernunft keine weitere Einteilung.
Auch, dass diese Einteilung in zwei Teile mit deren Unterabteilung nicht wirklich (so wie man wohl im Anfang durch das Beispiel der ersteren verleitet werden konnte, zu versuchen) hier vorgenommen wurde, davon lässt sich auch der Grund gar wohl einsehen. Denn weil es reine Vernunft ist, die hier in ihrem praktischen Gebrauch, mithin von Grundsätzen a priori und nicht von empirischen Bestimmungsgründen ausgehend, betrachtet wird, so wird die Einteilung der Analytik der r. pr. V. der eines Vernunftschlusses ähnlich ausfallen müssen, nämlich vom Allgemeinen im Obersatze (dem moralischen Prinzip), durch eine im Untersatze vorgenommene Subsumtion möglicher Handlungen (als guter oder böser)unter jenen, zu dem Schlusssatze, nämlich der subjektiven Willensbestimmung (einem Interesse an dem praktisch-möglichen Guten und der darauf gegründeten Maxime) fortgehend.
Demjenigen, der sich von den in der Analytik vorkommenden Sätzen hat überzeugen können, werden solche Vergleichungen Vergnügen machen; denn sie veranlassen mit Recht die Erwartung, es vielleicht dereinst bis zur Einsicht der Einheit des ganzen reinen Vernunftvermögens (des theoretischen sowohl als praktischen) bringen, und alles aus einem Prinzip ableiten zu können; welches das unvermeidliche Bedürfnis der menschlichen Vernunft ist, die nur in einer vollständig systematischen Einheit ihrer Erkenntnisse völlige Zufriedenheit findet.
Betrachten wir nun aller auch den Inhalt der Erkenntnis, die wir von einer reinen praktischen Vernunft, und durch dieselbe, haben können, so wie ihn die Analytik derselben darlegt, so finden sich, bei einer merkwürdigen Analogie zwischen ihr und der theoretischen, nicht weniger merkwürdige Unterschiede. In Ansehung der theoretischen könnte das Vermögen eines reinen Vernunfterkenntnisses a priori durch Beispiele aus Wissenschaften (bei denen man, da sie ihre Prinzipien auf so mancherlei Art durch methodischen Gebrauch auf die Probe stellen, nicht so leicht, wie im gemeinen Erkenntnisse, geheime Beimischung empirischer Erkenntnisgründe zu besorgen hat) ganz leicht und evident bewiesen werden. Aber dass reine Vernunft, ohne Beimischung irgendeines empirischen Bestimmungsgrundes, für sich allein auch praktisch sei, das musste man aus dem gemeinsten praktischen Vernunftgebrauch dartun können, indem man den obersten praktischen Grundsatz, als einen solchen, den jede natürliche Menschenvernunft, als völlig a priori, von keinen sinnlichen Datis abhängend, für das oberste Gesetz seines Willens erkennt, beglaubigte.
Man musste ihn zuerst, der Reinigkeit seines Ursprungs nach, selbst im Urteile dieser gemeinen Vernunft bewähren und rechtfertigen, ehe ihn noch die Wissenschaft in die Hände nehmen konnte, um Gebrauch von ihm zu machen, gleichsam als ein Faktum, das vor allem Vernünfteln über seine Möglichkeit und allen Folgerungen, die daraus zu ziehen sein möchten, vorhergeht. Aber dieser Umstand lässt sich auch aus dem kurz vorher Angeführten gar wohl erklären; weil praktische reine Vernunft notwendig von Grundsätzen anfangen muss, die also aller Wissenschaft, als erste Data, zum Grunde gelegt werden müssen, und nicht allererst aus ihr entspringen können. Diese Rechtfertigung der moralischen Prinzipien, als Grundsätze einer reinen Vernunft, konnte aber auch darum gar wohl, und mit genügsamer Sicherheit, durch bloße Berufung auf das Urteil des gemeinen Menschenverstandes geführt werden, weil sich alles Empirische, was sich als Bestimmungsgrund des Willens in unsere Maximen einschleichen möchte, durch das Gefühl des Vergnügens oder Schmerzens, das ihm sofern, als es Begierde erregt, notwendig anhängt, sofort kenntlich macht, diesem aber jene reine praktische Vernunft geradezu widersteht, es in ihr Prinzip, als Bedingung, aufzunehmen.
Die Ungleichartigkeit der Bestimmungsgründe (der empirischen und rationalen) wird durch diese Widerstrebung einer praktisch-gesetzgebenden Vernunft, wider alle sich einmengende Neigung, durch eine eigentümliche Art von Empfindung, welche aber nicht vor der Gesetzgebung der praktischen Vernunft vorhergeht, sondern vielmehr durch dieselbe allein und zwar als ein Zwang gewirkt wird, nämlich durch das Gefühl einer Achtung, dergleichen kein Mensch für Neigungen hat, sie mögen sein, welcher Art sie wollen, wohl aber fürs Gesetz, so kenntlich gemacht und so gehoben und hervorstechend, dass keiner, auch der gemeinste Menschenverstand, in einem vorgelegten Beispiele nicht den Augenblick inne werden sollte, dass durch empirische Gründe des Wollens ihm zwar ihren Anreizen zu folgen geraten, niemals aber einem anderen, als lediglich dem reinen praktischen Vernunftgesetze, zu gehorchen zugemutet werden könne.
Die Unterscheidung der Glückseligkeit sichere von der Sittenlehre, in derer ersteren empirische Prinzipien das ganze Fundament, von der zweiten aber auch nicht den mindesten Beisatz derselben ausmachen, ist nun in der Analytik der reinen praktischen Vernunft die erste und wichtigste ihr obliegende Beschäftigung, in der sie so pünktlich, ja, wenn es auch hieße, peinlich, verfahren muss, als je der Geometer in seinem Geschäfte. Es kommt aber dem Philosophen, der hier (wie jederzeit im Vernunfterkenntniss durch bloße Begriffe, ohne Konstruktion derselben) mit größerer Schwierigkeit zu kämpfen hat, weil er keine Anschauung (reinem Noumen) zum Grunde legen kann, doch auch zu statten, dass er, beinahe wie der Chemist, zu aller Zeit ein Experiment mit jedes Menschen praktischer Vernunft anstellen kann, um den moralischen (reinen) Bestimmungsgrund vom empirischen zu unterscheiden; wenn er nämlich zu dem empirisch-affizierten Willen (z.B. desjenigen, der gerne lügen möchte, weil er sich dadurch was erwerben kann) das moralische Gesetz (als Bestimmungsgrund) zusetzt.
Es ist, als ob der Scheidekünstler der Solution der Kalkerde in Salzgeist Alkali zusetzt; der Salzgeist verlässt sofort den Kalk, vereinigt sich mit dem Alkali, und jener wird zu Boden gestürzt. Ebenso haltet dem, der sonst ein ehrlicher Mann ist (oder sich doch diesmal nur in Gedanken in die Stelle eines ehrlichen Mannes versetzt), das moralische Gesetz vor, an dem er die Nichtswürdigkeit eines Lügners erkennt, sofort verlässt seine praktische Vernunft (im Urteil über das, was von ihm geschehen sollte) den Vorteil, vereinigt sich mit dem, was ihm die Achtung für seine eigene Person erhält (der Wahrhaftigkeit), und der Vorteil wird nun von jedermann, nachdem er von allem Anhängsel der Vernunft (welche nur gänzlich auf der Seite der Pflicht ist) abgesondert und gewaschen worden, gewogen, um mit der Vernunft noch wohl in anderen Fällen in Verbindung zu treten, nur nicht, wo er dem moralischen Gesetz, welches die Vernunft niemals verlässt, sondern sich innigst damit vereinigt, zuwider sein könnte.
Aber diese Unterscheidung des Glückseligkeitsprinzips von dem der Sittlichkeit ist darum nicht sofort Entgegensetzung beider, und die reine praktische Vernunft will nicht, man solle die Ansprüche auf Glückseligkeit aufgeben, sondern nur, sobald von Pflicht die Rede ist, darauf gar nicht Rücksicht nehmen. Es kann sogar in gewissem Betracht Pflicht sein, für seine Glückseligkeit zu sorgen; teils weil sie (wozu Geschicklichkeit, Gesundheit, Reichtum gehört) Mittel zu Erfüllung seiner Pflicht enthält, teils weil der Mangel derselben (z.B. Armut) Versuchungen enthält, seine Pflicht zu übertreten. Nur, seine Glückseligkeit zu befördern, kann unmittelbar niemals Pflicht, noch weniger ein Prinzip aller Pflicht sein. Da nun alle Bestimmungsgründe des Willens, außer dem einigen reinen praktischen Vernunftgesetze (dem moralischen), insgesamt empirisch sind, als solche also zum Glückseligkeitsprinzip gehören, so müssen sie insgesamt vom obersten sittlichen Grundsatz abgesondert, und ihm nie als Bedingung einverleibt werden, weil dieses ebenso sehr allen sittlichen Wert, als empirische Beimischung zu geometrischen Grundsätzen alle mathematische Evidenz, das Vortrefflichste, was (nach Platos Urteil) die Mathematik an sich hat, und das selbst allem Nutzen derselben vorgeht, aufheben würde.
Statt der Deduktion des obersten Prinzips der reinen praktischen Vernunft, d.h. der Erklärung der Möglichkeit einer dergleichen Erkenntnis a priori, konnte aber nichts weiter angeführt werden, als dass, wenn man die Möglichkeit der Freiheit einer wirkenden Ursache einsähe, man auch, nicht etwa bloß die Möglichkeit, sondern gar die Notwendigkeit des moralischen Gesetzes, als obersten praktischen Gesetzes vernünftiger Wesen, denen man Freiheit der Kausalität ihres Willens beilegt, einsehen würde; weil beide Begriffe so unzertrennlich verbunden sind, dass man praktische Freiheit auch durch Unabhängigkeit des Willens, von jedem anderen, außer allein dem moralischen Gesetz, definieren könnte.
Allein die Freiheit einer wirkenden Ursache, vornehmlich in der Sinnenwelt, kann ihrer Möglichkeit nach keineswegs eingesehen werden; glücklich! wenn wir nur, dass kein Beweis ihrer Unmöglichkeit stattfindet, hinreichend versichert werden können, und nun, durchs moralische Gesetz, welches dieselbe postuliert, genötigt, eben dadurch auch berechtigt werden, sie anzunehmen. Weil es indessen noch viele gibt, welche diese Freiheit noch immer glauben nach empirischen Prinzipien, wie jedes andere Naturvermögen, erklären zu können, und sie als psychologische Eigenschaft, deren Erklärung lediglich auf einer genaueren Untersuchung der Natur der Seele und der Triebfeder des Willens ankäme, nicht als transzendentales Prädikat der Kausalität eines Wesens, das zur Sinnenwelt gehört (wie es doch hierauf wirklich allein ankommt), betrachten, und so die herrliche Eröffnung, die uns durch reine praktische Vernunft vermittelst des moralischen Gesetzes widerfährt, nämlich die Eröffnung einer intelligibelen Welt, durch Realisierung des sonst transzendenten Begriffs der Freiheit und hiermit das moralische Gesetz selbst, welches durchaus keinen empirischen Bestimmungsgrund annimmt, aufheben, so wird es nötig sein, hier noch etwas zur Verwahrung wider dieses Blendwerk, und der Darstellung des Empirismus in der ganzen Blöße seiner Seichtigkeit anzuführen.
Der Begriff der Kausalität, als Naturnotwendigkeit, zum Unterschiede derselben, als Freiheit, betrifft nur die Existenz der Dinge, sofern sie in der Zeit bestimmbar ist, folglich als Erscheinungen, im Gegensatz ihrer Kausalität, als Dinge an sich selbst. Nimmt man nun die Bestimmungen der Existenz der Dinge in der Zeit für Bestimmungen der Dinge an sich selbst (welches die gewöhnlichste Vorstellungsart ist), so lässt sich die Notwendigkeit in Kausalverhältnisse mit der Freiheit auf keinerlei Weise vereinigen; sondern sie sind einander kontradiktorisch entgegengesetzt. Denn aus der ersteren folgt, dass eine jede Begebenheit, folglich auch jede Handlung, die in einem Zeitpunkt vorgeht, unter der Bedingung dessen, was in der vorhergehenden Zeit war, notwendig sei. Da nun die vergangene Zeit nicht mehr in meiner Gewalt ist, so muss jede Handlung, die ich ausübe, durch bestimmende Gründe, die nicht in meiner Gewalt sind, notwendig sein, d.h. ich bin in dem Zeitpunkt, darin ich handle, niemals frei.
Ja, wenn ich gleich mein ganzes Dasein als unabhängig von irgendeiner fremden Ursache (etwa von Gott) annähme, so dass die Bestimmungsgründe meiner Kausalität, sogar meiner ganzen Existenz, gar nicht außer mir wären, so würde dieses jene Naturnotwendigkeit doch nicht im Mindesten in Freiheit verwandeln. Denn in jedem Zeitpunkt stehe ich doch immer unter der Notwendigkeit, durch das zum Handeln bestimmt zu sein, was nicht in meiner Gewalt ist, und die a parte priori unendliche Reihe der Begebenheiten, die ich immer nur, nach einer schon vorherbestimmten Ordnung, fortsetzen, nirgends von selbst anfangen würde, wäre eine stetige Naturkette, meine Kausalität also niemals Freiheit.
Will man also einem Wesen, dessen Dasein in der Zeit bestimmt ist, Freiheit beilegen, so kann man es, so fern wenigstens, vom Gesetz der Naturnotwendigkeit aller Begebenheiten in seiner Existenz, mithin auch seiner Handlungen, nicht ausnehmen; denn das wäre so viel, als es dem blinden Ungefähr übergeben. Da dieses Gesetz aber unvermeidlich alle Kausalität der Dinge, sofern ihr Dasein in der Zeit bestimmbar ist, betrifft, so würde, wenn dieses die Art wäre, wonach man sich auch das Dasein dieser Dinge an sich selbst vorzustellen hätte, die Freiheit, als ein nichtiger und unmöglicher Begriff verworfen werden müssen. Folglich, wenn man sie noch retten will, so bleibt kein Weg übrig, als das Dasein eines Dinges, sofern es in der Zeit bestimmbar ist, folglich auch die Kausalität nach dem Gesetz der Naturnotwendigkeit, bloß der Erscheinung, die Freiheit aber eben demselben Wesen, als Dinge an sich selbst, beizulegen. So ist es allerdings unvermeidlich, wenn man beide einander widerwärtige Begriffe zugleich erhalten will; allein in der Anwendung, wenn man sie als in einer und derselben Handlung vereinigt, und also diese Vereinigung selbst erklären will, tun sich doch große Schwierigkeiten hervor, die eine solche Vereinigung untunlich zu machen scheinen.
Wenn ich von einem Menschen, der einen Diebstahl verübt, sage, diese Tat sei nach dem Naturgesetze der Kausalität aus den Bestimmungsgründen der vorhergehenden Zeit ein notwendiger Erfolg, so war es unmöglich, dass sie hat unterbleiben können; wie kann denn die Beurteilung nach dem moralischen Gesetz hierin eine Änderung machen, und voraussetzen, dass sie doch habe unterlassen werden können, weil das Gesetz sagt, sie hätte unterlassen werden sollen, d.h. wie kann derjenige, in demselben Zeitpunkt, in Absicht auf dieselbe Handlung, ganz frei heißen, in welchem, und in derselben Absicht, er doch unter einer unvermeidlichen Naturnotwendigkeit steht?
Eine Ausflucht darin suchen, dass man bloß die Art der Bestimmungsgründe seiner Kausalität nach dem Naturgesetz einem komparativen Begriff von Freiheit anpasst (nach welchem das bisweilen freie Wirkung heißt, davon der bestimmende Naturgrund innerlich im wirkenden Wesen liegt, z.B. das, was ein geworfener Körper verrichtet, wenn er in freier Bewegung ist, da man das Wort Freiheit braucht, weil er, während er im Fluge ist, nicht von außen wodurch getrieben wird, oder wie wir die Bewegung einer Uhr auch eine freie Bewegung nennen, weil sie ihren Zeiger selbst treibt, der also nicht äußerlich geschoben werden darf, ebenso die Handlungen des Menschen, ob sie gleich, durch ihre Bestimmungsgründe, die in der Zeit vorhergehen, notwendig sind, dennoch frei nennen, weil es doch innere durch unsere eigenen Kräfte hervorgebrachte Vorstellungen, dadurch nach veranlassenden Umständen erzeugte Begierden und mithin nach unserem eigenen Belieben bewirkte Handlungen sind), ist ein elender Behelf, womit sich noch immer einige hinhalten lassen, und so jenes schwere Problem mit einer kleinen Wortklauberei aufgelöst zu haben meinen, an dessen Auflösung Jahrtausende vergeblich gearbeitet haben, die daher wohl schwerlich so ganz auf der Oberfläche gefunden werden dürfte. Es kommt nämlich bei der Frage nach derjenigen Freiheit, die allen moralischen Gesetzen und der ihnen gemäßen Zurechnung zum Grunde gelegt werden muss, darauf gar nicht an, ob die nach einem Naturgesetz bestimmte Kausalität durch Bestimmungsgründe, die im Subjekt oder außer ihm liegen, und im ersteren Fall, ob sie durch Instinkt oder mit Vernunft gedachte Bestimmungsgründe notwendig sei; wenn diese bestimmenden Vorstellungen, nach dem Geständniss eben dieser Männer selbst, den Grund ihrer Existenz doch in der Zeit und zwar dem vorigen Zustand haben, dieser aber wieder in einem vorhergehenden etc., so mögen sie, diese Bestimmungen, immer innerlich sein, sie mögen psychologische und nicht mechanische Kausalität haben, d.h. durch Vorstellungen, und nicht durch körperliche Bewegung, Handlung hervorbringen, so sind es immer Bestimmungsgründe der Kausalität eines Wesens, sofern sein Dasein in der Zeit bestimmbar ist, mithin unter notwendig machenden Bedingungen der vergangenen Zeit, die also, wenn das Subjekt handeln soll, nicht mehr in seiner Gewalt sind, die also zwar psychologische Freiheit (wenn man ja dieses Wort von einer bloß inneren Verkettung der Vorstellungen der Seele brauchen will), aber doch Naturnotwendigkeit bei sich führen, mithin keine transzendentale Freiheit übrig lassen, welche als Unabhängigkeit von allem Empirischen und also von der Natur überhaupt gedacht werden muss, sie mag nun Gegenstand des inneren Sinnes, bloß in der Zeit, oder auch äußeren Sinne, im Raume und der Zeit zugleich betrachtet werden, ohne welche Freiheit (in der letzteren eigentlichen Bedeutung), die allein a priori praktisch ist, kein moralisches Gesetz, keine Zurechnung nach demselben, möglich ist. Eben um deswillen kann man auch alle Notwendigkeit der Begebenheiten in der Zeit, nach dem Naturgesetz der Kausalität, den Mechanismus der Natur nennen, ob man gleich darunter nicht versteht, dass Dinge, die ihm unterworfen sind, wirkliche materielle Maschinen sein müssten. Hier wird nur auf die Notwendigkeit der Verknüpfung der Begebenheiten in einer Zeitreihe, so wie sie sich nach dem Naturgesetz entwickelt, gesehen, man mag nun das Subjekt, in welchem dieser Ablauf geschieht, automaton materiale, da das Maschinenwesen durch Materie, oder mit Leibnizen spirituale, da es durch Vorstellungen betrieben wird, nennen, und wenn die Freiheit unseres Willens keine andere als die letztere (etwa die psychologische und komparative, nicht transzendentale, d.h. absolute zugleich) wäre, so würde sie im Grunde nichts besser, als die Freiheit eines Bratenwenders sein, der auch, wenn er einmal aufgezogen worden, von selbst seine Bewegungen verrichtet.
Um nun den scheinbaren Widerspruch zwischen Naturmechanismus und Freiheit in ein und derselben Handlung an dem vorgelegten Falle aufzuheben, muss man sich an das erinnern, was in der Kritik der reinen Vernunft gesagt war, oder daraus folgt, dass die Naturnotwendigkeit, welche mit der Freiheit des Subjekts nicht zusammen bestehen kann, bloß den Bestimmungen desjenigen Dinges anhängt, das unter Zeitbedingungen steht, folglich nur dem des handelnden Subjekts als Erscheinung, dass also sofern die Bestimmungsgründe einer jeden Handlung desselben in demjenigen liegen, was zur vergangenen Zeit gehört, und nicht mehr in seiner Gewalt ist (wozu auch seine schon begangenen Taten, und der ihm dadurch bestimmbare Charakter in seinen eigenen Augen, als Phänomen, gezählt werden müssen). Aber ebendasselbe Subjekt, das sich anderseits auch seiner, als Dinges an sich selbst, bewusst ist, betrachtet auch sein Dasein, sofern es nicht unter Zeitbedingungen steht, sich selbst aber nur als bestimmbar durch Gesetze, die es sich durch Vernunft selbst gibt, und in diesem seinem Dasein ist ihm nichts vorhergehend vor seiner Willensbestimmung, sondern jede Handlung, und überhaupt jede dem inneren Sinne gemäß wechselnde Bestimmung seines Daseins, selbst die ganze Reihenfolge seiner Existenz, als Sinnenwesen, ist im Bewusstsein seiner intelligibelen Existenz nichts als Folge, niemals aber als Bestimmungsgrund seiner Kausalität, als Noumens, anzusehen. In diesem Betracht nun kann das vernünftige Wesen, von einer jeden gesetzwidrigen Handlung, die es verübt, ob sie gleich, als Erscheinung, in dem Vergangenen hinreichend bestimmt, und sofern unausbleiblich notwendig ist, mit Recht sagen, dass er sie hätte unterlassen können; denn sie, mit allem Vergangenen, das sie bestimmt, gehört zu einem einzigen Phänomen seines Charakters, den er sich selbst verschafft, und nach welchem er sich, als einer von aller Sinnlichkeit unabhängigen Ursache, die Kausalität jener Erscheinungen selbst zurechnet.
Hiermit stimmen auch die Richteraussprüche desjenigen wundersamen Vermögens in uns, welches wir Gewissen nennen, vollkommen überein. Ein Mensch mag künsteln, soviel als er will, um ein gesetzwidriges Betragen, dessen er sich erinnert, sich als unvorsätzliches Versehen, als bloße Unbehutsamkeit, die man niemals gänzlich vermeiden kann, folglich als etwas, worin er vom Strom der Naturnotwendigkeit fortgerissen wäre, vorzumalen und sich darüber für schuldfrei zu erklären, so findet er doch, dass der Advokat, der zu seinem Vorteil spricht, den Ankläger in ihm keinesweges zum Verstummen bringen könne, wenn er sich bewusst ist, dass er zu der Zeit, als er das Unrecht verübte, nur bei Sinnen, d.h. im Gebrauch seiner Freiheit war, und gleichwohl erklärt er sich sein Vergehen, aus gewisser übeln, durch allmähliche Vernachlässigung der Achtsamkeit auf sich selbst zugezogener Gewohnheit, bis auf den Grad, dass er es als eine natürliche Folge derselben ansehen kann, ohne dass dieses ihn gleichwohl wider den Selbsttadel und den Verweis sichern kann, den er sich selbst macht. Darauf gründet sich denn auch die Reue über eine längst begangene Tat bei jeder Erinnerung derselben; eine schmerzhafte, durch moralische Gesinnung gewirkte Empfindung, die sofern praktisch leer ist, als sie nicht dazu dienen kann, das Geschehene ungeschehen zu machen, und sogar ungereimt sein würde (wie Priestley, als ein echter, konsequent verfahrender Fatalist, sie auch dafür erklärt, und in Ansehung welcher Offenherzigkeit er mehr Beifall verdient, als diejenige, welche, indem sie den Mechanismus des Willens in der Tat, die Freiheit desselben aber mit Worten behaupten, noch immer dafür gehalten sein wollen, dass sie jene, ohne doch die Möglichkeit einer solchen Zurechnung begreiflich zu machen, in ihrem synkretistischen System mit einschließen), aber, als Schmerz, doch ganz rechtmäßig ist, weil die Vernunft, wenn es auf das Gesetz unserer intelligibelen Existenz (das moralische) ankommt, keinen Zeitunterschied anerkennt, und nur fragt, ob die Begebenheit mir als Tat angehöre, alsdann aber immer dieselbe Empfindung damit moralisch verknüpft, sie mag jetzt geschehen, oder vorlängst geschehen sein. Denn das Sinnenleben hat in Ansehung des intelligibelen Bewusstseins seines Daseins (der Freiheit) absolute Einheit eines Phänomens, welches, sofern es bloß Erscheinungen von der Gesinnung, die das moralische Gesetz angeht (von dem Charakter), enthält, nicht nach der Naturnotwendigkeit, die ihm als Erscheinung zukommt, sondern nach der absoluten Spontaneität der Freiheit beurteilt werden muss.
Man kann also einräumen, dass, wenn es für uns möglich wäre, in eines Menschen Denkungsart, so wie sie sich durch innere sowohl als äußere Handlungen zeigt, so tiefe Einsicht zu haben, dass jede, auch die mindeste Triebfeder dazu uns bekannt würde, imgleichen alle auf diese wirkenden äußeren Veranlassungen, man eines Menschen Verhalten auf die Zukunft mit Gewissheit, so wie eine Mond oder Sonnenfinsternis, ausrechnen könnte, und dennoch dabei behaupten, dass der Mensch frei sei. Wenn wir nämlich noch eines andern Blicks (der uns aber freilich gar nicht verliehen ist, sondern an dessen Statt wir nur den Vernunftbegriff haben), nämlich einer intellektuellen Anschauung desselben Subjekts fähig wären, so würden wir doch inne werden, dass diese ganze Kette von Erscheinungen in Ansehung dessen, was nur immer das moralische Gesetz angehen kann, von der Spontaneität des Subjekts, als Dinges an sich selbst, abhängt, von deren Bestimmung sich gar keine physische Erklärung geben läßt.
In Ermangelung dieser Anschauung versichert uns das moralische Gesetz diesen Unterschied der Beziehung unserer Handlungen, als Erscheinungen, auf das Sinnenwesen unseres Subjekts, von derjenigen, dadurch dieses Sinnenwesen selbst auf das intelligibele Substrat in uns bezogen wird. In dieser Rücksicht, die unserer Vernunft natürlich, obgleich unerklärlich ist, lassen sich auch Beurteilungen rechtfertigen, die, mit aller Gewissenhaftigkeit gefällt, dennoch dem ersten Anschein nach aller Billigkeit ganz zu widerstreiten scheinen.
Es gibt Fälle, wo Menschen von Kindheit auf, selbst unter einer Erziehung, die, mit der ihrigen zugleich, andern ersprießlich war, dennoch so frühe Bosheit zeigen, und so bis in ihre Mannesjahre zu steigen fortfahren, dass man sie für geborene Bösewichter, und gänzlich, was die Denkungsart betrifft, für unbesserlich hält, gleichwohl aber sie wegen ihres Tuns und Lassens ebenso richtet, ihnen ihre Verbrechen ebenso als Schuld verweist, ja sie (die Kinder) selbst diese Verweise so ganz gegründet finden, als ob sie, ungeachtet der ihnen beigemessenen hoffnungslosen Naturbeschaffenheit ihres Gemüts, ebenso verantwortlich blieben, als jeder andere Mensch. Dieses würde nicht geschehen können, wenn wir nicht voraussetzten, dass alles, was aus seiner Willkür entspringt (wie ohne Zweifel jede vorsätzlich verübte Handlung), eine freie Kausalität zum Grunde habe, welche von der frühen Jugend an ihren Charakter in ihren Erscheinungen (den Handlungen) ausdrückt, die wegen der Gleichförmigkeit des Verhaltens einen Naturzusammenhang kenntlich machen, der aber nicht die arge Beschaffenheit des Willens notwendig macht, sondern vielmehr die Folge der freiwillig angenommenen bösen und unwandelbaren Grundsätze ist, welche ihn nur noch um desto verwerflicher und strafwürdiger machen.
Aber noch steht eine Schwierigkeit der Freiheit bevor, sofern sie mit dem Naturmechanismus, in einem Wesen, das zur Sinnenwelt gehört, vereinigt werden soll. Eine Schwierigkeit, die, selbst nachdem alles Bisherige eingewilligt worden, der Freiheit dennoch mit ihrem gänzlichen Untergang droht. Aber bei dieser Gefahr gibt ein Umstand doch zugleich Hoffnung zu einem für die Behauptung der Freiheit noch glücklichen Ausgang, nämlich dass dieselbe Schwierigkeit viel stärker (in der Tat, wie wir bald sehen werden, allein) das System drückt, in welchem die in Zeit und Raum bestimmbare Existenz für die Existenz der Dinge an sich selbst gehalten wird, sie uns also nicht nötigt, unsere vornehmste Voraussetzung von der Idealität der Zeit, als bloßer Form sinnlicher Anschauung, folglich als bloßer Vorstellungsart, die dem Subjekt als zur Sinnenwelt gehörig eigen ist, abzugehen, und also nur erfordert, sie mit dieser Idee zu vereinigen.
Wenn man uns nämlich auch einräumt, dass das intelligibele Subjekt in Ansehung einer gegebenen Handlung noch frei sein kann, obgleich es als Subjekt, das auch zur Sinnenwelt gehörig, in Ansehung derselben mechanisch bedingt ist, so scheint es doch, man müsse, so bald man annimmt, Gott, als allgemeines Urwesen, sei die Ursache auch der Existenz der Substanz (ein Satz, der niemals aufgegeben werden darf, ohne den Begriff von Gott als Wesen aller Wesen, und hiermit seine Allgenügsamkeit, auf die alles in der Theologie ankommt, zugleich mit aufzugeben), auch einräumen. Die Handlungen des Menschen haben in demjenigen ihren bestimmenden Grund, was gänzlich außer ihrer Gewalt ist, nämlich in der Kausalität eines von ihm unterschiedenen höchsten Wesens, von welchem das Dasein des ersteren, und die ganze Bestimmung seiner Kausalität ganz und gar abhängt.
In der Tat, wären die Handlungen des Menschen, so wie sie zu seinen Bestimmungen in der Zeit gehören, nicht bloße Bestimmungen desselben als Erscheinung, sondern als Dinges an sich selbst, so würde die Freiheit nicht zu retten sein. Der Mensch wäre Marionette, oder ein Vaucansonscher Automat, gezimmert und aufgezogen von dem obersten Meister aller Kunstwerke, und das Selbstbewusstsein würde es zwar zu einem denkenden Automaten machen, in welchem aber das Bewusstsein seiner Spontaneität, wenn sie für Freiheit gehalten wird, bloße Täuschung wäre, indem sie nur komparativ so genannt zu werden verdient, weil die nächsten bestimmenden Ursachen seiner Bewegung, und eine lange Reihe derselben zu ihren bestimmenden Ursachen hinauf, zwar innerlich sind, die letzte und höchste aber doch gänzlich in einer fremden Hand angetroffen wird. Daher sehe ich nicht ab, wie diejenigen welche noch immer dabei beharren, Zeit und Raum für zum Dasein der Dinge an sich selbst gehörige Bestimmungen anzusehen, hier die Fatalität der Handlungen vermeiden wollen, oder, wenn sie so geradezu (wie der sonst scharfsinnige Mendelssohn tat) beide nur als zur Existenz endlicher und abgeleiteter Wesen, aber nicht zu der des unendlichen Urwesens notwendig gehörige Bedingungen einräumen, sich rechtfertigen wollen, woher sie diese Befugnis nehmen, einen solchen Unterschied zu machen, sogar wie sie auch nur dem Widerspruch ausweichen wollen, den sie begehen, wenn sie das Dasein in der Zeit als den endlichen Dingen an sich notwendig anhängende Bestimmung ansehen, da Gott die Ursache dieses Daseins ist, er aber doch nicht die Ursache der Zeit (oder des Raums) selbst sein kann (weil diese als notwendige Bedingung a priori dem Dasein der Dinge vorausgesetzt sein muss), seine Kausalität folglich in Ansehung der Existenz dieser Dinge, selbst der Zeit nach, bedingt sein muss, wobei nun alle die Widersprüche gegen die Begriffe seiner Unendlichkeit und Unabhängigkeit unvermeidlich eintreten müssen. Hingegen ist es uns ganz leicht, die Bestimmung der göttlichen Existenz, als unabhängig von allen Zeitbedingungen, zum Unterschied von der eines Wesens der Sinnenwelt, als die Existenz eines Wesens an sich selbst, von der eines Dinges in der Erscheinung zu unterscheiden.
Daher, wenn man jene Idealität der Zeit und des Raums nicht annimmt, nur allein der Spinozismus übrig bleibt, in welchem Raum und Zeit wesentliche Bestimmungen des Urwesens selbst sind, die von ihm abhängige Dinge aber (also auch wir selbst) nicht Substanzen, sondern bloß ihm inhärierende Akzidenzen sind; weil, wenn diese Dinge bloß, als seine Wirkungen, in der Zeit existieren, welche die Bedingung ihrer Existenz an sich wäre, auch die Handlungen dieser Wesen bloß seine Handlungen sein müßten, die er irgendwo und irgendwann ausübte. Daher schließt der Spinozismus unerachtet der Ungereimtheit seiner Grundidee, doch weit bündiger, als es nach der Schöpfungstheorie geschehen kann, wenn die für Substanzen angenommene und an sich in der Zeit existierenden Wesen Wirkungen einer obersten Ursache, und doch nicht zugleich zu ihm und seiner Handlung, sondern für sich als Substanzen angesehen werden.
Die Auflösung obgedachter Schwierigkeit geschieht, kurz und einleuchtend, auf folgende Art: Wenn die Existenz in der Zeit eine bloße sinnliche Vorstellungsart der denkenden Wesen in der Welt ist, folglich sie, als Dinge an sich selbst, nicht angeht, so ist die Schöpfung dieser Wesen eine Schöpfung der Dinge an sich selbst; weil der Begriff einer Schöpfung nicht zu der sinnlichen Vorstellungsart der Existenz und zur Kausalität gehört, sondern nur auf Noumenon bezogen werden kann. Folglich, wenn ich von Wesen in der Sinnenwelt sage, sie sind erschaffen; so betrachte ich sie sofern als Noumenon So, wie es also ein Widerspruch wäre, zu sagen, Gott sei ein Schöpfer von Erscheinungen, so ist es auch ein Widerspruch, zu sagen, er sei, als Schöpfer, Ursache der Handlungen in der Sinnenwelt, mithin als Erscheinungen, wenn er gleich Ursache des Daseins der handelnden Wesen (als Noumenon ist.
Ist es nun möglich (wenn wir nur das Dasein in der Zeit für etwas, was bloß von Erscheinungen, nicht von Dingen an sich selbst gilt, annehmen), die Freiheit, unbeschadet dem Naturmechanismus der Handlungen als Erscheinungen, zu behaupten, so kann, dass die handelnden Wesen Geschöpfe sind, nicht die mindeste Änderung hierin machen, weil die Schöpfung ihre intelligibele, aber nicht sensibele Existenz betrifft, und also nicht als Bestimmungsgrund der Erscheinungen angesehen werden kann; welches aber ganz anders ausfallen würde, wenn die Weltwesen als Dinge an sich selbst in der Zeit existierten, da der Schöpfer der Substanz zugleich der Urheber des ganzen Maschinenwesens an dieser Substanz sein würde.
Von so großer Wichtigkeit ist die in der Krit. der r. spek. V. verrichtete Absonderung der Zeit (so wie des Raums) von der Existenz der Dinge an sich selbst. Die hier vorgetragene Auflösung der Schwierigkeit hat aber, wird man sagen, doch viel Schweres in sich, und ist einer hellen Darstellung kaum empfänglich. Allein, ist denn jede andere, die man versucht hat, oder versuchen mag, leichter und fasslicher Eher möchte man sagen, die dogmatischen Lehrer der Metaphysik hätten mehr ihre Verschmitztheit als Aufrichtigkeit darin bewiesen, dass sie diesen schwierigen Punkt, so weit wie möglich, aus den Augen brachten, in der Hoffnung, dass, wenn sie davon gar nicht sprächen, auch wohl niemand leichtlich an ihn denken würde. Wenn einer Wissenschaft geholfen werden soll, so müssen alle Schwierigkeiten aufgedeckt und sogar diejenigen aufgesucht werden, die ihr noch so in geheim im Wege liegen; denn jede derselben ruft ein Hilfsmittel auf, welches, ohne der Wissenschaft einen Zuwachs, es sei an Umfang, oder an Bestimmtheit, zu verschaffen, nicht gefunden werden kann, wodurch also selbst die Hindernisse Beförderungsmittel der Gründlichkeit der Wissenschaft werden. Dagegen, werden die Schwierigkeiten absichtlich verdeckt, oder bloß durch Palliativmittel gehoben, so brechen sie, über kurz oder lang, in unheilbare Übel aus, welche die Wissenschaft in einem gänzlichen Skeptizismus zu Grunde richten.
Da es eigentlich der Begriff der Freiheit ist, der, unter allen Ideen der reinen spekulativen Vernunft, allein so große Erweiterung im Felde des Übersinnlichen, wenn gleich nur in Ansehung des praktischen Erkenntnisses verschafft, so frage ich mich, woher denn ihm ausschließungsweise eine so große Fruchtbarkeit zu Teil geworden sei, indessen die übrigen zwar die leere Stelle für reine mögliche Verstandeswesen bezeichnen, den Begriff von ihnen aber durch nichts bestimmen können. Ich begreife bald, dass, da ich nichts ohne Kategorie denken kann, diese auch in der Idee der Vernunft von der Freiheit, mit der ich mich beschäftige, zuerst müsse aufgesucht werden, welche hier die Kategorie der Kausalität ist, und dass ich, wenn gleich dem Vernunftbegriff der Freiheit, als überschwenglichem Begriff keine korrespondierende Anschauung untergelegt werden kann, dennoch dem Verstandesbegriff (der Kausalität), für dessen Synthesis jener das Unbedingte fordert, zuvor eine sinnliche Anschauung gegeben werden müsse, dadurch ihm zuerst die objektive Realität gesichert wird.
Nun sind alle Kategorien in zwei Klassen, die mathematische, welche bloß auf die Einheit der Synthesis in der Vorstellung der Objekte, und die dynamische, welche auf die in der Vorstellung der Existenz der Objekte gehen, eingeteilt. Die erstere (die der Größe und der Qualität) enthalten jederzeit eine Synthesis des Gleichartigen, in welcher das Unbedingte, zu dem in der sinnlichen Anschauung gegebenen Bedingten in Raum und Zeit, da es selbst wiederum zum Raum und der Zeit gehören, und also immer wieder unbedingt sein musste, gar nicht kann gefunden werden; daher auch in der Dialektik der reinen theoretischen Vernunft die einander entgegengesetzten Arten, das Unbedingte und die Totalität der Bedingungen für sie zu finden, beide falsch waren.
Die Kategorien der zweiten Klasse (die der Kausalität und der Notwendigkeit eines Dinges) erforderten diese Gleichartigkeit (des Bedingten und der Bedingung in der Synthesis) gar nicht, weil hier nicht die Anschauung, wie sie aus einem Mannigfaltigen in ihr zusammengesetzt, sondern nur, wie die Existenz des ihr korrespondierenden bedingten Gegenstandes zu der Existenz der Bedingung (im Verstand als damit verknüpft) hinzukomme, vorgestellt werden solle, und da war es erlaubt, zu dem durchgängig Bedingten in der Sinnenwelt (sowohl in Ansehung der Kausalität als des zufälligen Daseins der Dinge selbst) das Unbedingte, obzwar übrigens unbestimmt, in der intelligibelen Welt zu setzen, und die Synthesis transzendent zu machen; daher denn auch in der Dialektik der r. spek. V. sich fand, dass beide, dem Schein nach, einander entgegengesetzte Arten, das Unbedingte zum Bedingten zu finden, z.B. in der Synthesis der Kausalität zum Bedingten, in der Reihe der Ursachen und Wirkungen der Sinnenwelt, die Kausalität, die weiter nicht sinnlich bedingt ist, zu denken, sich in der Tat nicht widerspreche, und dass dieselbe Handlung, die, als zur Sinnenwelt gehörig, jederzeit sinnlich bedingt, d.h. mechanisch-notwendig ist, doch zugleich auch, als zur Kausalität des handelnden Wesens, sofern es zur intelligibelen Welt gehörig ist, eine sinnlich unbedingte Kausalität zum Grunde haben, mithin als frei gedacht werden könne.
Nun kam es bloß darauf an, dass dieses Können in ein Sein verwandelt würde, d.h. dass man in einem wirklichen Falle, gleichsam durch ein Faktum, beweisen könne, dass gewisse Handlungen eine solche Kausalität (die intellektuelle, sinnlich unbedingte) voraussetzen, sie mögen nun wirklich, oder auch nur geboten, d.h. objektiv praktisch notwendig sein. An wirklich in der Erfahrung gegebenen Handlungen, als Begebenheiten der Sinnenwelt, konnten wir diese Verknüpfung nicht anzutreffen hoffen, weil die Kausalität durch Freiheit immer außer der Sinnenwelt im Intelligibelen gesucht werden muss. Andere Dinge, außer den Sinnenwesen, sind uns aber zur Wahrnehmung und Beobachtung nicht gegeben. Also blieb nichts übrig, als dass etwa ein unwidersprechlicher und zwar objektiver Grundsatz der Kausalität, welcher alle sinnliche Bedingung von ihrer Bestimmung ausschließt, d.h. ein Grundsatz, in welchem die Vernunft sich nicht weiter auf etwas anderes als Bestimmungsgrund in Ansehung der Kausalität beruft, sondern den sie durch jenen Grundsatz schon selbst enthält, und wo sie also, als reine Vernunft, selbst praktisch ist, gefunden werde. Dieser Grundsatz aber bedarf keines Suchens und keiner Erfindung; er ist längst in aller Menschen Vernunft gewesen und ihrem Wesen einverleibt, und ist der Grundsatz der Sittlichkeit. Also ist jene unbedingte Kausalität und das Vermögen derselben, die Freiheit, mit dieser aber ein Wesen (ich selber), welches zur Sinnenwelt gehört, doch zugleich als zur intelligibelen gehörig nicht bloß unbestimmt und problematisch gedacht (welches schon die spekulative Vernunft als tunlich ausmitteln konnte), sondern sogar in Ansehung des Gesetzes ihrer Kausalität bestimmt und assertorisch erkannt, und so uns die Wirklichkeit der intelligibelen Welt, und zwar in praktischer Rücksicht bestimmt, gegeben worden, und diese Bestimmung, die in theoretischer Absicht transzendent (überschwenglich) sein würde, ist in praktischer immanent.
Dergleichen Schritt aber konnten wir in Ansehung der zweiten dynamischen Idee, nämlich der eines notwendigen Wesens nicht tun. Wir konnten zu ihm aus der Sinnenwelt, ohne Vermittelung der ersteren dyn. Idee, nicht hinauf kommen. Denn, wollten wir es versuchen, so müßten wir den Sprung gewagt haben, alles das, was uns gegeben ist, zu verlassen, und uns zu dem hinzuschwingen, wovon uns auch nichts gegeben ist, wodurch wir die Verknüpfung eines solchen intelligibelen Wesens mit der Sinnenwelt vermitteln könnten (weil das notwendige Wesen als außer uns gegeben erkannt werden sollte); welches dagegen in Ansehung unseres eignen Subjekts, sofern es sich durchs moralische Gesetz einerseits als intelligibeles Wesen (vermöge der Freiheit) bestimmt, andererseits als nach dieser Bestimmung in der Sinnenwelt tätig, selbst erkennt, wie jetzt der Augenschein dartut, ganz wohl möglich ist.
Der einzige Begriff der Freiheit gestattet es, dass wir nicht außer uns hinausgehen dürfen, um das Unbedingte und Intelligibele zu dem Bedingten und Sinnlichen zu finden. Denn es ist unsere Vernunft selber, die sich durchs höchste und unbedingte praktische Gesetz, und das Wesen, das sich dieses Gesetzes bewusst ist (unsere eigene Person), als zur reinen Verstandeswelt gehörig, und zwar sogar mit Bestimmung der Art, wie es als ein solches tätig sein könne, erkennt. So lässt sich begreifen, warum in dem ganzen Vernunftvermögen nur das Praktische dasjenige sein könne, welches uns über die Sinnenwelt hinaushilft, und Erkenntnisse von einer übersinnlichen Ordnung und Verknüpfung verschaffe, die aber eben darum freilich nur so weit, als es gerade für die reine praktische Absicht nötig ist, ausgedehnt werden können.
Nur auf eines sei es mir erlaubt bei dieser Gelegenheit noch aufmerksam zu machen, nämlich dass jeder Schritt, den man mit der reinen Vernunft tut, sogar im praktischen Felde, wo man auf subtile Spekulation gar nicht Rücksicht nimmt, dennoch sich so genau und zwar von selbst an alle Momente der Kritik der theoretischen Vernunft anschließe, als ob jeder mit überlegter Vorsicht, bloß um dieser Bestätigung zu verschaffen, ausgedacht wäre. Eine solche auf keinerlei Weise gesuchte, sondern (wie man sich selbst davon überzeugen kann, wenn man nur die moralischen Nachforschungen bis zu ihren Prinzipien fortsetzen will) sich von selbst findende, genaue Eintreffung der wichtigsten Sätze der praktischen Vernunft, mit denen oft zu subtil und unnötig scheinenden Bemerkungen der Kritik der spekulativen, überrascht und setzt in Verwunderung, und bestärkt die schon von andern erkannte und gepriesene Maxime, in jeder wissenschaftlichen Untersuchung mit aller möglichen Genauigkeit und Offenheit seinen Gang ungestört fortzusetzen, ohne sich an das zu kehren, wo wider sie außer ihrem Feld etwa verstoßen möchte, sondern sie für sich allein, so viel man kann, wahr und vollständig zu vollführen.
Öftere Beobachtung hat mich überzeugt, dass, wenn man diese Geschäfte zu Ende gebracht hat, das, was in der Hälfte desselben, in Betracht anderer Lehren außerhalb, mir bisweilen sehr bedenklich schien, wenn ich diese Bedenklichkeit nur so lange aus den Augen ließ, und bloß auf mein Geschäft Acht hatte, bis es vollendet sei, endlich auf unerwartete Weise mit demjenigen vollkommen zusammenstimmte, was sich ohne die mindeste Rücksicht auf jene Lehren, ohne Parteilichkeit und Vorliebe für dieselbe, von selbst gefunden hatte. Schriftsteller würden sich manche Irrtümer, manche verlorne Mühe (weil sie auf Blendwerk gestellt war) ersparen, wenn sie sich nur entschließen könnten, mit etwas mehr Offenheit zu Werke zu gehen.
Zweites Buch
Dialektik der reinen praktischen Vernunft
Erstes Hauptstück
Von einer Dialektik der reinen praktischen Vernunft überhaupt
Die reine Vernunft hat jederzeit ihre Dialektik, man mag sie in ihrem spekulativen oder praktischen Gebrauch betrachten; denn sie verlangt die absolute Totalität der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten, und diese kann schlechterdings nur in Dingen an sich selbst angetroffen werden. Da aber alle Begriffe der Dinge auf Anschauungen bezogen werden müssen, welche, bei uns Menschen, niemals anders als sinnlich sein können, mithin die Gegenstände nicht als Dinge an sich selbst, sondern bloß als Erscheinungen erkennen lassen, in deren Reihe des Bedingten und der Bedingungen das Unbedingte niemals angetroffen werden kann, so entspringt ein unvermeidlicher Schein aus der Anwendung dieser Vernunftidee der Totalität der Bedingungen (mithin des Unbedingten) auf Erscheinungen, als wären sie Sachen an sich selbst (denn dafür werden sie, in Ermangelung einer warnenden Kritik, jederzeit gehalten), der aber niemals als trüglich bemerkt werden würde, wenn er sich nicht durch einen Widerstreit der Vernunft mit sich selbst, in der Anwendung ihres Grundsatzes, das Unbedingte zu allem Bedingten vorauszusetzen, auf Erscheinungen, selbst verrieten. Hierdurch wird aber die Vernunft genötigt, diesem Scheine nachzuspüren, woraus er entspringe, und wie er gehoben werden könne, welches nicht anders, als durch eine vollständige Kritik des ganzen reinen Vernunftvermögens, geschehen kann; so dass die Antinomie der reinen Vernunft, die in ihrer Dialektik offenbar wird, in der Tat die wohltätigste Verirrung ist, in die die menschliche Vernunft je hat geraten können, indem sie uns zuletzt antreibt, den Schlüssel zu suchen, aus diesem Labyrinth herauszukommen, der, wenn er gefunden wurde, noch das entdeckt, was man nicht suchte und doch bedarf, nämlich eine Aussicht in eine höhere, unveränderliche Ordnung der Dinge, in der wir schon jetzt sind, und in der unser Dasein der höchsten Vernunftbestimmung gemäß fortzusetzen wir durch bestimmte Vorschriften nunmehr angewiesen werden können.
Wie im spekulativen Gebrauch der reinen Vernunft jene natürliche Dialektik aufzulösen, und der Irrtum, aus einem übrigens natürlichen Scheine, zu verhüten sei, kann man in der Kritik jenes Vermögens ausführlich antreffen. Aber der Vernunft in ihrem praktischen Gebrauch geht es um nichts besser. Sie sucht, als reine praktische Vernunft, zu dem praktisch-Bedingten (was auf Neigungen und Naturbedürfnis beruht) ebenfalls das Unbedingte, und zwar nicht als Bestimmungsgrund des Willens, sondern, wenn dieser auch (im moralischen Gesetze) gegeben wurde, die unbedingte Totalität des Gegenstandes der reinen praktischen Vernunft, unter dem Namen des höchsten Guts.
Diese Idee praktisch, d.h. für die Maxime unseres vernünftigen Verhaltens, hinreichend zu bestimmen, ist die Weisheitslehre, und diese wiederum, als Wissenschaft, ist Philosophie, in der Bedeutung, wie die Alten das Wort verstanden, bei denen sie eine Anweisung zu dem Begriffe war, worin das höchste Gut zu setzen, und zum Verhalten, durch welches es zu erwerben sei. Es wäre gut, wenn wir dieses Wort bei seiner alten Bedeutung ließen, als eine Lehre vom höchsten Gut, sofern die Vernunft bestrebt ist, es darin zur Wissenschaft zu bringen. Denn einesteils würde die angehängte einschränkende Bedingung dem griechischen Ausdruck (welcher Liebe zur Weisheit bedeutet) angemessen und doch zugleich hinreichend sein, die Liebe zur Wissenschaft, mithin aller spekulativen Erkenntnis der Vernunft, sofern sie ihr, sowohl zu jenem Begriffe, als auch dem praktischen Bestimmungsgrund dienlich ist, unter dem Namen der Philosophie, mit zu befassen, und doch den Hauptzweck, um dessentwillen sie allein Weisheitslehre genannt werden kann, nicht aus den Augen verlieren lassen. Anderen Teils würde es auch nicht übel sein, den Eigendünkel desjenigen, der es wagte, sich des Titels eines Philosophen selbst anzumaßen, abzuschrecken, wenn man ihm schon durch die Definition den Maßstab der Selbstschätzung vorhielte, der seine Ansprüche sehr herabstimmen wird; denn ein Weisheitslehrer zu sein, möchte wohl etwas mehr, als einen Schüler bedeuten, der noch immer nicht weit genug gekommen ist, um sich selbst, vielweniger um andere, mit sicherer Erwartung eines so hohen Zwecks, zu leiten; es würde einen Meister in Kenntnis der Weisheit bedeuten, welches mehr sagen will, als ein bescheidener Mann sich selber anmaßen wird, und Philosophie würde, so wie die Weisheit, selbst noch immer ein Ideal bleiben, welches objektiv in der Vernunft allein vollständig vorgestellt wird, subjektiv aber, für die Person, nur das Ziel seiner unaufhörlichen Bestrebung ist, und in dessen Besitz, unter dem angemaßten Namen eines Philosophen, zu sein, nur der vorzugeben berechtigt ist, der auch die unfehlbare Wirkung derselben (in Beherrschung seiner selbst, und dem ungezweifelten Interesse, das er vorzüglich am allgemeinen Guten nimmt) an seiner Person, als Beispiel, aufstellen kann, welches die Alten auch forderten, um jenen Ehrennamen verdienen zu können.
In Ansehung der Dialektik der reinen praktischen Vernunft, im Punkte der Bestimmung des Begriffs vom höchsten Gute (welche, wenn ihre Auflösung gelingt, eben sowohl, als die der theoretischen, die wohltätigste Wirkung erwarten läßt, dadurch dass die aufrichtig angestellte und nicht verhehlten Widersprüche der reinen praktischen Vernunft mit ihr selbst zur vollständigen Kritik ihres eigenen Vermögens nötigen), haben wir nur noch eine Erinnerung voranzuschicken.
Das moralische Gesetz ist der alleinige Bestimmungsgrund des reinen Willens. Da dieses aber bloß formal ist (nämlich, allein die Form der Maxime, als allgemein gesetzgebend, fordert), so abstrahiert es, als Bestimmungsgrund, von aller Materie, mithin von allem Objekte, des Wollens. Mithin mag das höchste Gut immer der ganze Gegenstand einer reinen praktischen Vernunft, d.h. eines reinen Willens sein, so ist es darum doch nicht für den Bestimmungsgrund desselben zu halten, und das moralische Gesetz muss allein als dem Grund angesehen werden, jenes, und dessen Bewirkung oder Beförderung, sich zum Objekt zu machen. Diese Erinnerung ist in einem so delikaten Falle, als die Bestimmung sittlicher Prinzipien ist, wo auch die kleinste Mißdeutung Gesinnungen verfälscht, von Erheblichkeit. Denn man wird aus der Analytik ersehen haben, dass, wenn man vor dem moralischen Gesetz irgendein Objekt, unter dem Namen eines Guten, als Bestimmungsgrund des Willens annimmt, und von ihm denn das oberste praktische Prinzip ableitet, dieses alsdann jederzeit Heteronomie herbeibringen und das moralische Prinzip verdrängen würde.
Es versteht sich aber von selbst, dass, wenn im Begriff des höchsten Guts das moralische Gesetz, als oberste Bedingung, schon mit eingeschlossen ist, alsdann das höchste Gut nicht bloß Objekt, sondern auch sein Begriff, und die Vorstellung der durch unsere praktische Vernunft möglichen Existenz desselben zugleich der Bestimmungsgrund des reinen Willens sei; weil alsdann in der Tat das in diesem Begriff schon eingeschlossene und mitgedachte moralische Gesetz und kein anderer Gegenstand, nach dem Prinzip der Autonomie, den Willen bestimmt. Diese Ordnung der Begriffe von der Willensbestimmung darf nicht aus den Augen gelassen werden; weil man sonst sich selbst mißversteht und sich zu widersprechen glaubt, wo doch alles in der vollkommensten Harmonie nebeneinander steht.
Zweites Hauptstück
Von der Dialektik der reinen Vernunft in Bestimmung des Begriffs vom höchsten Gut
Der Begriff des Höchsten enthält schon eine Zweideutigkeit, die, wenn man darauf nicht Acht hat, unnötige Streitigkeiten veranlassen kann. Das Höchste kann das Oberste (supremum) oder auch das Vollendete (consummatum) bedeuten. Das Erstere ist diejenige Bedingung, die selbst unbedingt, d.h. keiner andern untergeordnet ist (originarium); das zweite dasjenige Ganze, das kein Teil eines noch größeren Ganzen von derselben Art ist (perfectissimum). Dass Tugend (als die Würdigkeit glücklich zu sein) die oberste Bedingung alles dessen, was uns nur wünschenswert scheinen mag, mithin auch aller unserer Bewerbung um Glückseligkeit, mithin das oberste Gut sei, ist in der Analytik bewiesen worden. Darum ist sie aber noch nicht das ganze und vollendete Gut, als Gegenstand des Begehrungsvermögens vernünftiger endlicher Wesen; denn, um das zu sein, wird auch Glückseligkeit dazu erfordert, und zwar nicht bloß in den parteiischen Augen der Person, die sich selbst zum Zweck macht, sondern selbst im Urteil einer unparteiischen Vernunft, die jene überhaupt in der Welt als Zweck an sich betrachtet. Denn der Glückseligkeit bedürftig, ihrer auch würdig, dennoch aber derselben nicht teilhaftig zu sein, kann mit dem vollkommenen Wollen eines vernünftigen Wesens, welches zugleich alle Gewalt hätte, wenn wir uns auch nur ein solches zum Versuche denken, gar nicht zusammen bestehen. Sofern nun Tugend und Glückseligkeit zusammen den Besitz des höchsten Guts in einer Person, hierbei aber auch Glückseligkeit, ganz genau in Proportion der Sittlichkeit (als Wert der Person und deren Würdigkeit glücklich zu sein) ausgeteilt, das höchste Gut einer möglichen Welt ausmachen, so bedeutet dieses das Ganze, das vollendete Gute, worin doch Tugend immer, als Bedingung, das oberste Gut ist, weil es weiter keine Bedingung über sich hat, Glückseligkeit immer etwas, was dem, der sie besitzt, zwar angenehm, aber nicht für sich allein schlechterdings und in aller Rücksicht gut ist, sondern jederzeit das moralische gesetzmäßige Verhalten als Bedingung voraussetzt.
Zwei in einem Begriffe notwendig verbundene Bestimmungen müssen als Grund und Folge verknüpft sein, und zwar entweder so, dass diese Einheit als analytisch (logische Verknüpfung) oder als synthetisch (reale Verbindung), jene nach dem Gesetz der Identität, diese der Kausalität betrachtet wird. Die Verknüpfung der Tugend mit der Glückseligkeit kann also entweder so verstanden werden, dass die Bestrebung tugendhaft zu sein und die vernünftige Bewerbung um Glückseligkeit nicht zwei verschiedene, sondern ganz identische Handlungen wären, da denn der ersteren keine andere Maxime, als zu der letztern zum Grunde gelegt zu werden brauchte, oder jene Verknüpfung wird darauf ausgesetzt, dass Tugend die Glückseligkeit als etwas von dem Bewusstsein der ersteren Unterschiedenes, wie die Ursache eine Wirkung, hervorbringe.
Von den alten griechischen Schulen waren eigentlich nur zwei, die in Bestimmung des Begriffs vom höchsten Gute so fern zwar einerlei Methode befolgten, dass sie Tugend und Glückseligkeit nicht als zwei verschiedene Elemente des höchsten Guts gelten ließen, mithin die Einheit des Prinzips nach der Regel der Identität suchten; aber darin schieden sie sich wiederum, dass sie unter beiden den Grundbegriff verschiedentlich wählten. Der Epikureer sagte: sich seiner auf Glückseligkeit führenden Maxime bewusst sein, das ist Tugend; der Stoiker: sich seiner Tugend bewusst sein, ist Glückseligkeit. Dem ersteren war Klugheit so viel als Sittlichkeit; dem zweiten, der eine höhere Benennung für die Tugend wählte, war Sittlichkeit allein wahre Weisheit.
Man muss bedauren, dass die Scharfsinnigkeit dieser Männer (die man doch zugleich darüber bewundern muss, dass sie in so frühen Zeiten schon alle erdenklichen Wege philosophischer Eroberungen versuchten) unglücklich angewandt war, zwischen äußerst ungleichartigen Begriffen, dem der Glückseligkeit und dem der Tugend, Identität zu ergrübeln. Allein es war dem dialektischen Geist ihrer Zeiten angemessen, was auch jetzt bisweilen subtile Köpfe verleitet, wesentliche und nie zu vereinigende Unterschiede in Prinzipien dadurch aufzuheben, dass man sie in Wortstreit zu verwandeln sucht, und so, dem Scheine nach, Einheit des Begriffs bloß unter verschiedenen Benennungen erkünstelt, und dieses trifft gemeiniglich solche Fälle, wo die Vereinigung ungleichartiger Gründe so tief oder hoch liegt, oder eine so gänzliche Umänderung der sonst im philosophischen System angenommenen Lehren erfodern würde, dass man Scheu trägt, sich in den realen Unterschied tief einzulassen, und ihn lieber als Uneinigkeit in bloßen Formalien behandelt.
Indem beide Schulen Einerleiheit der praktischen Prinzipien der Tugend und Glückseligkeit zu ergrübeln suchten, so waren sie darum nicht unter sich einhellig, wie sie diese Identität herauszwingen wollten, sondern schieden sich in unendlichen Weiten von einander, indem die eine ihr Prinzip auf der ästhetischen, die andere auf der logischen Seite, jene im Bewusstsein der sinnlichen Bedürfnisse, die andere in der Unabhängigkeit der praktischen Vernunft von allen sinnlichen Bestimmungsgründen setzte. Der Begriff der Tugend lag, nach dem Epikureer, schon in der Maxime, seine eigene Glückseligkeit zu befördern; das Gefühl der Glückseligkeit war dagegen nach dem Stoiker schon im Bewusstsein seiner Tugend enthalten. Was aber in einem andern Begriffe enthalten ist, ist zwar mit einem Teil des Enthaltenden, aber nicht mit dem Ganzen einerlei, und zwei Ganze können überdem spezifisch voneinander unterschieden sein, ob sie zwar aus eben demselben Stoff bestehen, wenn nämlich die Teile in beiden auf ganz verschiedene Art zu einem Ganzen verbunden werden. Der Stoiker behauptete, Tugend sei das ganze höchste Gut, und Glückseligkeit nur das Bewusstsein des Besitzes derselben, als zum Zustand des Subjekts gehörig. Der Epikureer behauptete, Glückseligkeit sei das ganze höchste Gut, und Tugend nur die Form der Maxime, sich um sie zu bewerben, nämlich im vernünftigen Gebrauch der Mittel zu derselben.
Nun ist aber aus der Analytik klar, dass die Maximen der Tugend und die der eigenen Glückseligkeit in Ansehung ihres obersten praktischen Prinzips ganz ungleichartig sind, und, weit gefehlt, einhellig zu sein, ob sie gleich zu einem höchsten Guten gehören, um das letztere möglich zu machen, einander in demselben Subjekt gar sehr einschränken und Abbruch tun. Also bleibt die Frage, wie ist das höchste Gut praktisch möglich, noch immer, unerachtet aller bisherigen Koalitionsversuche, eine unaufgelöste Aufgabe. Das aber, was sie zu einer schwer zu lösenden Aufgabe macht, ist in der Analytik gegeben, nämlich dass Glückseligkeit und Sittlichkeit zwei spezifisch ganz verschiedene Elemente des höchsten Guts sind, und ihre Verbindung also nicht analytisch erkannt werden könne (dass etwa der, so seine Glückseligkeit sucht, in diesem seinem Verhalten sich durch bloße Auflösung seiner Begriffe tugendhaft, oder der, so der Tugend folgt, sich im Bewusstsein eines solchen Verhaltens schon ipso facto glücklich finden werde), sondern eine Synthesis der Begriffe sei. Weil aber diese Verbindung als a priori, mithin praktisch notwendig, folglich nicht aus der Erfahrung abgeleitet, erkannt wird, und die Möglichkeit des höchsten Guts also auf keinen empirischen Prinzipien beruht, so wird die Deduktion dieses Begriffs transzendental sein müssen. Es ist a priori (moralisch) notwendig, das höchste Gut durch Freiheit des Willens hervorzubringen; es muss also auch die Bedingung der Möglichkeit desselben lediglich auf Erkenntnisgründen a priori beruhen.
Die Antinomie der praktischen Vernunft
In dem höchsten für uns praktischen, d.h. durch unsern Willen wirklich zu machenden, Gute werden Tugend und Glückseligkeit als notwendig verbunden gedacht, so, dass das eine durch reine praktische Vernunft nicht angenommen werden kann, ohne dass das andere auch zu ihm gehöre. Nun ist diese Verbindung (wie eine jede überhaupt) entweder analytischoder synthetisch. Da diese gegebene aber nicht analytisch sein kann, wie nur eben vorher gezeigt wurde, so muss sie synthetisch, und zwar als Verknüpfung der Ursache mit der Wirkung gedacht werden; weil sie ein praktisches Gut, d.h. was durch Handlung möglich ist, betrifft. Es muss also entweder die Begierde nach Glückseligkeit die Bewegursache zu Maximen der Tugend, oder die Maxime der Tugend muss die wirkende Ursache der Glückseligkeit sein.
Das Erste ist schlechterdings unmöglich, weil (wie in der Analytik bewiesen wurde) Maximen, die den Bestimmungsgrund des Willens in dem Verlangen nach seiner Glückseligkeit setzen, gar nicht moralisch sind, und keine Tugend gründen können. Das zweite ist aber auch unmöglich, weil alle praktische Verknüpfung der Ursachen und der Wirkungen in der Welt, als Erfolg der Willensbestimmung sich nicht nach moralischen Gesinnungen des Willens, sondern der Kenntnis der Naturgesetze und dem physischen Vermögen, sie zu seinen Absichten zu gebrauchen, richtet, folglich keine notwendige und zum höchsten Gut zureichende Verknüpfung der Glückseligkeit mit der Tugend in der Welt, durch die pünktlichste Beobachtung der moralischen Gesetze, erwartet werden kann. Da nun die Beförderung des höchsten Guts, welches diese Verknüpfung in seinem Begriff enthält, ein a priori notwendiges Objekt unseres Willens ist, und mit dem moralischen Gesetz unzertrennlich zusammenhängt, so muss die Unmöglichkeit des ersteren auch die Falschheit des zweiten beweisen. Ist also das höchste Gut nach praktischen Regeln unmöglich, so muss auch das moralische Gesetz, welches gebietet, dasselbe zu befördern, phantastisch und auf leere eingebildete Zwecke gestellt, mithin an sich falsch sein.
Kritische Aufhebung der Antinomie der praktischen Vernunft
In der Antinomie der reinen spekulativen Vernunft findet sich ein ähnlicher Widerstreit zwischen Naturnotwendigkeit und Freiheit, in der Kausalität der Begebenheiten in der Welt. Er wurde dadurch gehoben, dass bewiesen wurde, es sei kein wahrer Widerstreit, wenn man die Begebenheiten, und selbst die Welt, darin sie sich ereignen, (wie man auch soll) nur als Erscheinungen betrachtet; da ein und dasselbe handelnde Wesen, als Erscheinung (selbst vor seinem eignen innern Sinne) eine Kausalität in der Sinnenwelt hat, die jederzeit dem Naturmechanismus gemäß ist, in Ansehung derselben Begebenheit aber, so fern sich die handelnde Person zugleich als Noumenon betrachtet (als reine Intelligenz, in seinem nicht der Zeit nach bestimmbaren Dasein), einen Bestimmungsgrund jener Kausalität nach Naturgesetzen, der selbst von allem Naturgesetz frei ist, enthalten könne.
Mit der vorliegenden Antinomie der reinen praktischen Vernunft ist es nun ebenso bewandt. Der erste von den zwei Sätzen, dass das Bestreben nach Glückseligkeit einen Grund tugendhafter Gesinnung hervorbringe, ist schlechterdings falsch; der zweite aber, dass Tugendgesinnung notwendig Glückseligkeit hervorbringe, ist nicht schlechterdings, sondern nur, so fern sie als die Form der Kausalität in der Sinnenwelt betrachtet wird, und, mithin, wenn ich das Dasein in derselben für die einzige Art der Existenz des vernünftigen Wesens annehme, also nur bedingter Weise falsch. Da ich aber nicht allein befugt bin, mein Dasein auch als Noumenon in einer Verstandeswelt zu denken, sondern sogar am moralischen Gesetz einen rein intellektuellen Bestimmungsgrund meiner Kausalität (in der Sinnenwelt) habe, so ist es nicht unmöglich, dass die Sittlichkeit der Gesinnung einen, wo nicht unmittelbaren, doch mittelbaren (vermittelst eines intelligibelen Urhebers der Natur) und zwar notwendigen Zusammenhang, als Ursache, mit der Glückseligkeit, als Wirkung in der Sinnenwelt habe, welche Verbindung in einer Natur, die bloß Objekt der Sinne ist, niemals anders als zufällig stattfinden, und zum höchsten Gute nicht zulangen kann.
Also ist, unerachtet dieses scheinbaren Widerstreits einer praktischen Vernunft mit sich selbst, das höchste Gut, der notwendige höchste Zweck eines moralisch bestimmten Willens, ein wahres Objekt derselben; denn es ist praktisch möglich, und die Maximen des letzteren, die sich darauf ihrer Materie nach beziehen, haben objektive Realität, welche anfänglich durch jene Antinomie in Verbindung der Sittlichkeit mit Glückseligkeit nach einem allgemeinen Gesetz getroffen wurde, aber aus bloßem Missverstand, weil man das Verhältnis zwischen Erscheinungen für ein Verhältnis der Dinge an sich selbst zu diesen Erscheinungen hielt.
Wenn wir uns genötigt sehen, die Möglichkeit des höchsten Guts, dieses durch die Vernunft allen vernünftigen Wesen ausgesteckten Ziels aller ihrer moralischen Wünsche, in solcher Weite, nämlich in der Verknüpfung mit einer intelligibelen Welt, zu suchen, so muss es befremden, dass gleichwohl die Philosophen, alter sowohl, als neuer Zeiten, die Glückseligkeit mit der Tugend in ganz geziemender Proportion schon in diesem Leben (in der Sinnenwelt) haben finden, oder sich ihrer bewusst zu sein haben überreden können. Denn Epikur sowohl, als die Stoiker, erhoben die Glückseligkeit, die aus dem Bewusstsein der Tugend im Leben entspringe, über alles, und der erstere war in seinen praktischen Vorschriften nicht so niedrig gesinnt, als man aus den Prinzipien seiner Theorie, die er zum Erklären, nicht zum Handeln brauchte, schließen möchte, oder, wie sie viele, durch den Ausdruck Wollust, für Zufriedenheit, verleitet, ausdeuteten, sondern rechnete die uneigennützigste Ausübung des Guten mit zu den Genußarten der innigsten Freude, und die Gnügsamkeit und Bändigung der Neigungen, so wie sie immer der strengste Moralphilosoph fordern mag, gehörte mit zu seinem Plan eines Vergnügens (er verstand darunter das stets fröhliche Herz); wobei er von den Stoikern vornehmlich nur darin abwich, dass er in diesem Vergnügen den Bewegungsgrund setzte, welches die Letzteren, und zwar mit Recht, verweigerten. Denn einesteils fiel der tugendhafte Epikur, so wie noch jetzt viele moralisch wohlgesinnte, obgleich über ihre Prinzipien nicht tief genug nachdenkende Männer, in den Fehler, die tugendhafte Gesinnung in jenen Personen schon vorauszusetzen, für die er die Triebfeder zur Tugend zuerst angeben wollte (und in der Tat kann der Rechtschaffene sich nicht glücklich finden, wenn er sich nicht zuvor seiner Rechtschaffenheit bewusst ist; weil, bei jener Gesinnung, die Verweise, die er bei Übertretungen sich selbst zu machen durch seine eigene Denkungsart genötigt sein würde, und die moralische Selbstverdammung ihn alles Genusses der Annehmlichkeit, die sonst sein Zustand enthalten mag, berauben würden).
Allein die Frage ist, wodurch wird eine solche Gesinnung und Denkungsart, den Wert seines Daseins zu schätzen, zuerst möglich; da vor derselben noch gar kein Gefühl für einen moralischen Wert überhaupt im Subjekt angetroffen werden würde. Der Mensch wird, wenn er tugendhaft ist, freilich, ohne sich in jeder Handlung seiner Rechtschaffenheit bewusst zu sein, des Lebens nicht froh werden, so günstig ihm auch das Glück im physischen Zustande desselben sein mag; aber um ihn allererst tugendhaft zu machen, mithin ehe er noch den moralischen Wert seiner Existenz so hoch anschlägt, kann man ihm da wohl die Seelenruhe anpreisen, die aus dem Bewusstsein einer Rechtschaffenheit entspringen werde, für die er doch keinen Sinn hat?
Andrerseits aber liegt hier immer der Grund zu einem Fehler des Erschleichens (vitium subreptionis) und gleichsam einer optischen Illusion in dem Selbstbewusstsein dessen, was man tut, zum Unterschied dessen, was man empfindet, die auch der Versuchteste nicht völlig vermeiden kann. Die moralische Gesinnung ist mit einem Bewusstsein der Bestimmung des Willens unmittelbar durchs Gesetz notwendig verbunden. Nun ist das Bewusstsein einer Bestimmung des Begehrungsvermögens immer der Grund eines Wohlgefallens an der Handlung, die dadurch hervorgebracht wird; aber diese Lust, dieses Wohlgefallen an sich selbst, ist nicht der Bestimmungsgrund der Handlung, sondern die Bestimmung des Willens unmittelbar, bloß durch die Vernunft, ist der Grund des Gefühls der Lust, und jene bleibt eine reine praktische nicht ästhetische Bestimmung des Begehrungsvermögens. Da diese Bestimmung nun innerlich gerade dieselbe Wirkung eines Antriebs zur Tätigkeit tut, als ein Gefühl der Annehmlichkeit, die aus der begehrten Handlung erwartet wird, würde getan haben, so sehen wir das, was wir selbst tun, leichtlich für etwas an, was wir bloß leidentlich fühlen, und nehmen die moralische Triebfeder für sinnlichen Antrieb, wie das allemal in der sogenannten Täuschung der Sinne (hier des inneren) zu geschehen pflegt.
Es ist etwas sehr Erhabenes in der menschlichen Natur, unmittelbar durch ein reines Vernunftgesetz zu Handlungen bestimmt zu werden, und sogar die Täuschung, das Subjektive dieser intellektuellen Bestimmbarkeit des Willens für etwas Ästhetisches und Wirkung eines besondern sinnlichen Gefühls (denn ein intellektuelles wäre ein Widerspruch) zu halten. Es ist auch von großer Wichtigkeit, auf diese Eigenschaft unserer Persönlichkeit aufmerksam zu machen, und die Wirkung der Vernunft auf dieses Gefühl bestmöglichst zu kultivieren. Aber man muss sich auch in Acht nehmen, durch unechte Hochpreisungen dieses moralischen Bestimmungsgrundes, als Triebfeder, indem man ihm Gefühle besonderer Freuden, als Gründe (die doch nur Folgen sind) unterlegt, die eigentliche echte Triebfeder, das Gesetz selbst, gleichsam wie durch eine falsche Folie, herabzusetzen und zu verunstalten. Achtung und nicht Vergnügen, oder Genuß der Glückseligkeit, ist also etwas, wofür kein der Vernunft zum Grunde gelegtes, vorhergehendes Gefühl (weil dieses jederzeit ästhetisch und pathologisch sein würde) möglich ist, als Bewusstsein der unmittelbaren Nötigung des Willens durch Gesetz, ist kaum ein Analogon des Gefühls der Lust, indem es im Verhältniss zum Begehrungsvermögen gerade eben dasselbe, aber aus andern Quellen tut; durch diese Vorstellungsart aber kann man allein erreichen, was man sucht, nämlich dass Handlungen nicht bloß pflichtmäßig (angenehmen Gefühlen zu Folge), sondern aus Pflicht geschehen, welches der wahre Zweck aller moralischen Bildung sein muss.
Hat man aber nicht ein Wort, welches nicht einen Genuß, wie das der Glückseligkeit, bezeichnete, aber doch ein Wohlgefallen an seiner Existenz, ein Analogon der Glückseligkeit, welche das Bewusstsein der Tugend notwendig begleiten muss, anzeigte? Ja! dieses Wort ist Selbstzufriedenheit, welches in seiner eigentlichen Bedeutung jederzeit nur ein negatives Wohlgefallen an seiner Existenz andeutet, in welchem man nichts zu bedürfen sich bewusst ist. Freiheit und das Bewusstsein derselben, als eines Vermögens, mit überwiegender Gesinnung das moralische Gesetz zu befolgen, ist Unabhängigkeit von Neigungen, wenigstens als bestimmenden (wenngleich nicht als affizierenden) Bewegursachen unseres Begehrens, und, sofern, als ich mir derselben in der Befolgung meiner moralischen Maximen bewusst bin, der einzige Quell einer notwendig damit verbundenen, auf keinem besonderen Gefühl beruhenden, unveränderlichen Zufriedenheit, und diese kann intellektuell heißen. Die ästhetische (die uneigentlich so genannt wird), welche auf der Befriedigung der Neigungen, so fein sie auch immer ausgeklügelt werden mögen, beruht, kann niemals dem, was man sich darüber denkt, adäquat sein. Denn die Neigungen wechseln, wachsen mit der Begünstigung, die man ihnen widerfahren läßt, und lassen immer ein noch größeres Leeres übrig, als man auszufüllen gedacht hat. Daher sind sie einem vernünftigen Wesen jederzeit lästig, und wenn es sie gleich nicht abzulegen vermag, so nötigen sie ihm doch den Wunsch ab, ihrer entledigt zu sein. Selbst eine Neigung zum Pflichtmäßigen (z.B. zur Wohltätigkeit) kann zwar die Wirksamkeit der moralischen Maximen sehr erleichtern, aber keine hervorbringen. Denn alles muss in dieser auf der Vorstellung des Gesetzes, als Bestimmungsgrunde, angelegt sein, wenn die Handlung nicht bloß Legalität, sondern auch Moralität enthalten soll.
Neigung ist blind und knechtisch, sie mag nun gutartig sein oder nicht, und die Vernunft, wo es auf Sittlichkeit ankommt, muss nicht bloß den Vormund derselben vorstellen, sondern, ohne auf sie Rücksicht zu nehmen, als reine praktische Vernunft ihr eigenes Interesse ganz allein besorgen. Selbst dies Gefühl des Mitleids und der weichherzigen Teilnehmung, wenn es vor der Überlegung, was Pflicht sei, vorhergeht und Bestimmungsgrund wird, ist wohldenkenden Personen selbst lästig, bringt ihre überlegten Maximen in Verwirrung, und bewirkt den Wunsch, ihrer entledigt und allein der gesetzgebenden Vernunft unterworfen zu sein. Hieraus lässt sich verstehen, wie das Bewusstsein dieses Vermögens einer reinen praktischen Vernunft durch Tat (die Tugend) ein Bewusstsein der Obermacht über seine Neigungen, hiermit also der Unabhängigkeit von denselben, folglich auch der Unzufriedenheit, die diese immer begleitet, und also ein negatives Wohlgefallen mit seinem Zustand, d.h. Zufriedenheit, hervorbringen könne, welche in ihrer Quelle Zufriedenheit mit seiner Person ist. Die Freiheit selbst wird auf solche Weise (nämlich indirekt) eines Genusses fähig, welcher nicht Glückseligkeit heißen kann, weil er nicht vom positiven Beitritt eines Gefühls abhängt, auch genau zu reden nicht Seligkeit, weil er nicht gänzliche Unabhängigkeit von Neigungen und Bedürfnissen enthält, der aber doch der letztern ähnlich ist, sofern nämlich wenigstens seine Willensbestimmung sich von ihrem Einflusse frei halten kann, und also, wenigstens seinem Ursprung nach, der Selbstgenügsamkeit analogisch ist, die man nur dem höchsten Wesen beilegen kann.
Aus dieser Auflösung der Antinomie der praktischen reinen Vernunft folgt, dass sich in praktischen Grundsätzen eine natürliche und notwendige Verbindung zwischen dem Bewusstsein der Sittlichkeit, und der Erwartung einer ihr proportionierten Glückseligkeit, als Folge derselben, wenigstens als möglich denken (darum aber freilich noch eben nicht erkennen und einsehen) lasse; dagegen, dass Grundsätze der Bewerbung um Glückseligkeit unmöglich Sittlichkeit hervorbringen können, dass also das oberste Gut die erste Bedingung des höchsten Guts) Sittlichkeit, Glückseligkeit dagegen zwar das zweite Element desselben ausmache, doch so, dass diese nur die moralisch-bedingte, aber doch notwendige Folge der ersteren sei. In dieser Unterordnung allein ist das höchste Gut das ganze Objekt der reinen praktischen Vernunft, die es sich notwendig als möglich vorstellen muss, weil es ein Gebot derselben ist, zu dessen Hervorbringung alles Mögliche beizutragen. Weil aber die Möglichkeit einer solchen Verbindung des Bedingten mit seiner Bedingung gänzlich zum übersinnlichen Verhältniss der Dinge gehört, und nach Gesetzen der Sinnenwelt gar nicht gegeben werden kann, obzwar die praktische Folge dieser Idee, nämlich die Handlungen, die darauf abzielen, das höchste Gut wirklich zu machen, zur Sinnenwelt gehören, so werden wir die Gründe jener Möglichkeit erstlich in Ansehung dessen, was unmittelbar in unserer Gewalt ist, und dann zweitens in dem, was uns Vernunft, als Ergänzung unseres Unvermögens, zur Möglichkeit des höchsten Guts (nach praktischen Prinzipien notwendig) darbietet und nicht in unserer Gewalt ist, darzustellen suchen.
III. Von dem Primat der reinen praktischen Vernunft in ihrer Verbindung mit der spekulativen
Unter dem Primat zwischen zweien oder mehreren durch Vernunft verbundenen Dingen verstehe ich den Vorzug des einen, der erste Bestimmungsgrund der Verbindung mit allen übrigen zu sein. In engerer, praktischer Bedeutung bedeutet es den Vorzug des Interesses des einen, so fern ihm (welches keinem andern nachgesetzt werden kann) das Interesse der andern untergeordnet ist. Einem jeden Vermögen des Gemüts kann man ein Interesse beilegen, d.h. ein Prinzip, welches die Bedingung enthält, unter welcher allein die Ausübung desselben befördert wird. Die Vernunft, als das Vermögen der Prinzipien, bestimmt das Interesse aller Gemütskräfte, das ihrige aber sich selbst. Das Interesse ihres spekulativen Gebrauchs besteht in der Erkenntnis des Objekts bis zu den höchsten Prinzipien a priori, das des praktischen Gebrauchs in der Bestimmung des Willens, in Ansehung des letzten und vollständigen Zwecks. Das, was zur Möglichkeit eines Vernunftgebrauchs überhaupt erfoderlich ist, nämlich dass die Prinzipien und Behauptungen derselben einander nicht widersprechen müssen, macht keinen Teil ihres Interesses aus, sondern ist die Bedingung, überhaupt Vernunft zu haben; nur die Erweiterung, nicht die bloße Zusammenstimmung mit sich selbst, wird zum Interesse derselben gezählt.
Wenn praktische Vernunft nichts weiter annehmen und als gegeben denken darf, als was spekulative Vernunft, für sich, ihr aus ihrer Einsicht darreichen konnte, so führt diese das Primat. Gesetzt aber, sie hätte für sich ursprüngliche Prinzipien a priori, mit denen gewisse theoretische Positionen unzertrennlich verbunden wären, die sich gleichwohl aller möglichen Einsicht der spekulativen Vernunft entzögen (ob sie zwar derselben auch nicht widersprechen müßten), so ist die Frage, welches Interesse das oberste sei (nicht, welches weichen müßte, denn eines widerstreitet dem andern nicht notwendig); ob spekulative Vernunft, die nicht von allem dem weiß, was praktische ihr anzunehmen darbietet, diese Sätze aufnehmen, und sie, ob sie gleich für sie überschwenglich sind, mit ihren Begriffen, als einen fremden auf sie übertragenen Besitz, zu vereinigen suchen müsse, oder ob sie berechtigt sei, ihrem eigenen abgesonderten Interesse hartnäckig zu folgen, und, nach der Kanonik des Epikurs, alles als leere Vernünftelei auszuschlagen, was seine objektive Realität nicht durch augenscheinliche in der Erfahrung aufzustellende Beispiele beglaubigen kann, wenn es gleich noch so sehr mit dem Interesse des praktischen (reinen) Gebrauchs verwebt, an sich auch der theoretischen nicht widersprechend wäre, bloß weil es wirklich so fern dem Interesse der spekulativen Vernunft Abbruch tut, dass es die Grenzen, die diese sich selbst gesetzt, aufhebt, und sie allem Unsinn oder Wahnsinn der Einbildungskraft preisgibt.
In der Tat, sofern praktische Vernunft als pathologisch bedingt, d.h. das Interesse der Neigungen unter dem sinnlichen Prinzip der Glückseligkeit bloß verwaltend, zum Grunde gelegt würde, so ließe sich diese Zumutung an die spekulative Vernunft gar nicht tun. Mahomets Paradies, oder der Theosophen und Mystiker schmelzende Vereinigung mit der Gottheit, so wie jedem sein Sinn steht, würden der Vernunft ihre Ungeheuer aufdringen, und es wäre ebenso gut, gar keine zu haben, als sie auf solche Weise allen Träumereien preiszugeben. Allein wenn reine Vernunft für sich praktisch sein kann und es wirklich ist, wie das Bewusstsein des moralischen Gesetzes es ausweist, so ist es doch immer nur eine und dieselbe Vernunft, die, es sei in theoretischer oder praktischer Absicht, nach Prinzipien a priori urteilt, und da ist es klar, dass, wenn ihr Vermögen in der ersteren gleich nicht zulangt, gewisse Sätze behauptend festzusetzen, indessen dass sie ihr auch eben nicht widersprechen, eben diese Sätze, sobald sie unabtrennlich zum praktischen Interesse der reinen Vernunft gehören, zwar als ein ihr fremdes Angebot, das nicht auf ihrem Boden erwachsen, aber doch hinreichend beglaubigt ist, annehmen, und sie, mit allem, was sie als spekulative Vernunft in ihrer Macht hat, zu vergleichen und zu verknüpfen suchen müsse; doch sich bescheidend, dass dieses nicht ihre Einsichten, aber doch Erweiterungen ihres Gebrauchs in irgendeiner anderen, nämlich praktischen, Absicht sind, welches ihrem Interesse, das in der Einschränkung des spekulativen Frevels besteht, ganz und gar nicht zuwider ist.
In der Verbindung also der reinen spekulativen mit der reinen praktischen Vernunft zu einem Erkenntnisse führt die letztere das Primat, vorausgesetzt nämlich, dass diese Verbindung nicht etwa zufällig und beliebig, sondern a priori auf der Vernunft selbst gegründet, mithin notwendig sei. Denn es würde ohne diese Unterordnung ein Widerstreit der Vernunft mit ihr selbst entstehen; weil, wenn sie einander bloß beigeordnet (koordiniert) wären, die erstere für sich ihre Grenze eng verschließen und nichts von der letzteren in ihr Gebiet aufnehmen, diese aber ihre Grenzen dennoch über alles ausdehnen, und, wo es ihr Bedürfnis erheischt, jene innerhalb der ihrigen mit zu befassen suchen würde. Der spekulativen Vernunft aber untergeordnet zu sein, und also die Ordnung umzukehren, kann man der reinen praktischen gar nicht zumuten, weil alles Interesse zuletzt praktisch ist, und selbst das der spekulativen Vernunft nur bedingt und im praktischen Gebrauch allein vollständig ist.
Die Unsterblichkeit der Seele, als ein Postulat der reinen praktischen Vernunft
Die Bewirkung des höchsten Guts in der Welt ist das notwendige Objekt eines durchs moralische Gesetz bestimmbaren Willens. In diesem aber ist die völlige Angemessenheit der Gesinnungen zum moralischen Gesetz die oberste Bedingung des höchsten Guts. Sie muss also eben sowohl möglich sein, als ihr Objekt, weil sie in demselben Gebot dieses zu befördern enthalten ist. Die völlige Angemessenheit des Willens aber zum moralischen Gesetz ist Heiligkeit, eine Vollkommenheit, deren kein vernünftiges Wesen der Sinnenwelt, in keinem Zeitpunkt seines Daseins, fähig ist. Da sie indessen gleichwohl als praktisch notwendig gefedert wird, so kann sie nur in einem ins Unendliche gehenden Progressus zu jener völligen Angemessenheit angetroffen werden, und es ist, nach Prinzipien der reinen praktischen Vernunft, notwendig, eine solche praktische Fortschreitung als das reale Objekt unseres Willens anzunehmen.
Dieser unendliche Progressus ist aber nur unter Voraussetzung einer ins Unendliche fortdauernden Existenz und Persönlichkeit desselben vernünftigen Wesens (welche man die Unsterblichkeit der Seele nennt) möglich. Also ist das höchste Gut, praktisch, nur unter der Voraussetzung der Unsterblichkeit der Seele möglich; mithin diese, als unzertrennlich mit dem moralischen Gesetz verbunden, ein Postulat der reinen praktischen Vernunft (worunter ich einen theoretischen, als solchen aber nicht erweislichen Satz verstehe, so fern er einem a priori unbedingt geltenden praktischen Gesetz unzertrennlich anhängt).
Der Satz von der moralischen Bestimmung unserer Natur, nur allein in einem ins Unendliche gehenden Fortschritt zur völligen Angemessenheit mit dem Sittengesetz gelangen zu können, ist von dem größten Nutzen, nicht bloß in Rücksicht auf die gegenwärtige Ergänzung des Unvermögens der spekulativen Vernunft, sondern auch in Ansehung der Religion. In Ermangelung desselben wird entweder das moralische Gesetz von seiner Heiligkeit gänzlich abgewürdigt, indem man es sich als nachsichtlich (indulgent), und so unserer Behaglichkeit angemessen, verkünstelt, oder auch seinen Beruf und zugleich Erwartung zu einer unerreichbaren Bestimmung, nämlich einem verhofften völligen Erwerb der Heiligkeit des Willens, spannt, und sich in schwärmende, dem Selbsterkenntnis ganz widersprechende theosophische Träume verliert, durch welches beides das unaufhörliche Streben, zur pünktlichen und durchgängigen Befolgung eines strengen unnachsichtlichen, dennoch aber nicht idealischen, sondern wahren Vernunftgebots, nur verhindert wird.
Einem vernünftigen, aber endlichen Wesen ist nur der Progressus ins Unendliche, von niederen zu den höheren Stufen der moralischen Vollkommenheit, möglich. Der Unendliche, dem die Zeitbedingung nichts ist, sieht, in dieser für uns endlosen Reihe, das Ganze der Angemessenheit mit dem moralischen Gesetz, und die Heiligkeit, die sein Gebot unnachlässlich fordert, um seiner Gerechtigkeit in dem Anteil, den er jedem am höchsten Gut bestimmt, gemäß zu sein, ist in einer einzigen intellektuellen Anschauung des Daseins vernünftiger Wesen ganz anzutreffen. Was dem Geschöpfe allein in Ansehung der Hoffnung dieses Anteils zukommen kann, wäre das Bewusstsein seiner erprüften Gesinnung, um aus seinem bisherigen Fortschritt vom Schlechteren zum moralisch Besseren und dem dadurch ihm bekannt gewordenen unwandelbaren Vorsatz eine fernere ununterbrochene Fortsetzung desselben, wie weit seine Existenz auch immer reichen mag, selbst über dieses Leben hinaus, zu hoffen, und so, zwar niemals hier oder in irgendeinem absehlichen künftigen Zeitpunkt seines Daseins, sondern nur in der (Gott allein übersehbaren) Unendlichkeit seiner Fortdauer, dem Willen desselben (ohne Nachsicht oder Erfassung, welche sich mit der Gerechtigkeit nicht zusammenreimt) völlig adäquat zu sein.
Das Dasein Gottes, als ein Postulat der reinen praktischen Vernunft
Das moralische Gesetz führte in der vorhergehenden Zergliederung zur praktischen Aufgabe, welche, ohne allen Beitritt sinnlicher Triebfedern, bloß durch reine Vernunft vorgeschrieben wird, nämlich der notwendigen Vollständigkeit des ersten und vornehmsten Teils des höchsten Guts, der Sittlichkeit, und, da diese nur in einer Ewigkeit völlig aufgelöst werden kann, zum Postulat der Unsterblichkeit. Eben dieses Gesetz muss auch zur Möglichkeit des zweiten Elements des höchsten Guts, nämlich der jener Sittlichkeit angemessenen Glückseligkeit, ebenso uneigennützig, wie vorher, aus bloßer unparteiischer Vernunft, nämlich auf die Voraussetzung des Daseins einer dieser Wirkung adäquaten Ursache führen, d.h. die Existenz Gottes, als zur Möglichkeit des höchsten Guts (welches Objekt unseres Willens mit der moralischen Gesetzgebung der reinen Vernunft notwendig verbunden ist) notwendig gehörig, postulieren. Wir wollen diesen Zusammenhang überzeugend darstellen.
Glückseligkeit ist der Zustand eines vernünftigen Wesens in der Welt, dem es, im Ganzen seiner Existenz, alles nach Wunsch und Willen geht, und beruht also auf der Übereinstimmung der Natur zu seinem ganzen Zweck, imgleichen zum wesentlichen Bestimmungsgrund seines Willens. Nun gebietet das moralische Gesetz, als ein Gesetz der Freiheit, durch Bestimmungsgründe, die von der Natur und der Übereinstimmung derselben zu unserem Begehrungsvermögen (als Triebfedern) ganz unabhängig sein sollen; das handelnde vernünftige Wesen in der Welt aber ist doch nicht zugleich Ursache der Welt und der Natur selbst. Also ist in dem moralischen Gesetz nicht der mindeste Grund zu einem notwendigen Zusammenhang zwischen Sittlichkeit und der ihr proportionierten Glückseligkeit eines zur Welt als Teil gehörigen, und daher von ihr abhängigen, Wesens, welches eben darum durch seinen Willen nicht Ursache dieser Natur sein, und sie, was seine Glückseligkeit betrifft, mit seinen praktischen Grundsätzen aus eigenen Kräften nicht durchgängig einstimmig machen kann. Gleichwohl wird in der praktischen Aufgabe der reinen Vernunft, d.h. der notwendigen Bearbeitung zum höchsten Gut, ein solcher Zusammenhang als notwendig postuliert, wir sollen das höchste Gut (welches also doch möglich sein muss) zu befördern suchen. Also wird auch das Dasein einer von der Natur unterschiedenen Ursache der gesamten Natur, welche den Grund dieses Zusammenhanges, nämlich der genauen Übereinstimmung der Glückseligkeit mit der Sittlichkeit, enthalte, postuliert.
Diese oberste Ursache aber soll den Grund der Übereinstimmung der Natur nicht bloß mit einem Gesetz des Willens der vernünftigen Wesen, sondern mit der Vorstellung dieses Gesetzes, so fern diese es sich zum obersten Bestimmungsgrunde des Willens setzen, also nicht bloß mit den Sitten der Form nach, sondern auch ihrer Sittlichkeit, als dem Bewegungsgrund derselben, d.h. mit ihrer moralischen Gesinnung enthalten. Also ist das höchste Gut in der Welt nur möglich, so fern eine oberste der Natur angenommen wird, die eine der moralischen Gesinnung gemäße Kausalität hat. Nun ist ein Wesen, das der Handlungen nach der Vorstellung von Gesetzen fähig ist, eine Intelligenz (vernünftig Wesen) und die Kausalität eines solchen Wesens nach dieser Vorstellung der Gesetze ein Wille desselben. Also ist die oberste Ursache der Natur, so fern sie zum höchsten Gute vorausgesetzt werden muss, ein Wesen, das durch Verstand und Willen die Ursache (folglich der Urheber) der Natur ist, d.h. Gott. Folglich ist das Postulat der Möglichkeit des höchsten abgeleiteten Guts (der besten Welt) zugleich das Postulat der Wirklichkeit eines höchsten ursprünglichen Guts, nämlich der Existenz Gottes. Nun war es Pflicht für uns, das höchste Gut zu befördern, mithin nicht allein Befugnis, sondern auch mit der Pflicht als Bedürfnis verbundene Notwendigkeit, die Möglichkeit dieses höchsten Guts vorauszusetzen, welches, da es nur unter der Bedingung des Daseins Gottes stattfindet, die Voraussetzung desselben mit der Pflicht unzertrennlich verbindet, d.h. es ist moralisch notwendig, das Dasein Gottes anzunehmen.
Hier ist nun wohl zu merken, dass diese moralische Notwendigkeit subjektiv, d.h. Bedürfnis, und nicht objektiv, d.h. selbst Pflicht sei; denn es kann gar keine Pflicht geben, die Existenz eines Dinges anzunehmen (weil dieses bloß den theoretischen Gebrauch der Vernunft angeht). Auch wird hierunter nicht verstanden, dass die Annehmung des Daseins Gottes, als eines Grundes aller Verbindlichkeit überhaupt, notwendig sei (denn dieser beruht, wie hinreichend bewiesen worden, lediglich auf der Autonomie der Vernunft selbst). Zur Pflicht gehört hier nur die Bearbeitung zu Hervorbringung und Beförderung des höchsten Guts in der Welt, dessen Möglichkeit also postuliert werden kann, die aber unsere Vernunft nicht anders denkbar findet, als unter Voraussetzung einer höchsten Intelligenz, deren Dasein anzunehmen also mit dem Bewußtsein unserer Pflicht verbunden ist, obzwar diese Annehmung selbst für die theoretische Vernunft gehört, in Ansehung deren allein sie, als Erklärungsgrund betrachtet, Hypothese, in Beziehung aber auf die Verständlichkeit eines uns doch durchs moralische Gesetz aufgegebenen Objekts (des höchsten Guts), mithin eines Bedürfnisses in praktischer Absicht, Glaube, und zwar reiner Vernunftglaube, heißen kann, weil bloß reine Vernunft (sowohl ihrem theoretischen als praktischen Gebrauch nach) die Quelle ist, daraus er entspringt.
Aus dieser Deduktion wird es nunmehr begreiflich, warum die griechischen Schulen zur Auflösung ihres Problems von der praktischen Möglichkeit des höchsten Guts niemals gelangen konnten; weil sie nur immer die Regel des Gebrauchs, den der Wille des Menschen von seiner Freiheit macht, zum einzigen und für sich allein zureichenden Grunde derselben machten, ohne, ihrem Bedünken nach, das Dasein Gottes dazu zu bedürfen. Zwar taten sie daran recht, dass sie das Prinzip der Sitten unabhängig von diesem Postulat, für sich selbst, aus dem Verhältnis der Vernunft allein zum Willen, festsetzten, und es mithin zur obersten praktischen Bedingung des höchsten Guts machten; es war aber darum nicht die ganze Bedingung der Möglichkeit desselben. Die Epikureer hatten nun zwar ein ganz falsches Prinzip der Sitten zum obersten angenommen, nämlich das der Glückseligkeit, und eine Maxime der beliebigen Wahl, nach jedes seiner Neigung, für ein Gesetz untergeschoben; aber darin verfuhren sie doch konsequent genug, dass sie ihr höchstes Gut eben so, nämlich der Niedrigkeit ihres Grundsatzes proportionierlich, abwürdigten, und keine größere Glückseligkeit erwarteten, als die sich durch menschliche Klugheit (wozu auch Enthaltsamkeit und Mäßigung der Neigungen gehört) erwerben lässt, die, wie man weiß, kümmerlich genug, und nach Umständen sehr verschiedentlich, ausfallen muss; die Ausnahmen, welche ihre Maximen unaufhörlich einräumen mussten, und die sie zu Gesetzen untauglich machen, nicht einmal gerechnet.
Die Stoiker hatten dagegen ihr oberstes praktisches Prinzip, nämlich die Tugend, als Bedingung des höchsten Guts ganz richtig gewählt, aber, indem sie den Grad derselben, der für das reine Gesetz derselben erforderlich ist, als in diesem Leben völlig erreichbar vorstellten, nicht allein das moralische Vermögen des Menschen, unter dem Namen eines Weisen, über alle Schranken seiner Natur hoch gespannt, und etwas, das aller Menschenkenntnis widerspricht, angenommen, sondern auch vornehmlich das zweite zum höchsten Gut gehörige Bestandstück, nämlich die Glückseligkeit, gar nicht für einen besonderen Gegenstand des menschlichen Begehrungsvermögens wollen gelten lassen, sondern ihren Weisen, gleich einer Gottheit, im Bewußtsein der Vortrefflichkeit seiner Person, von der Natur (in Absicht auf seine Zufriedenheit) ganz unabhängig gemacht, indem sie ihn zwar Übeln des Lebens aussetzten, aber nicht unterwarfen (zugleich auch als frei vom Bösen darstellten), und so wirklich das zweite Element des höchsten Guts, eigene Glückseligkeit wegließen, indem sie es bloß im Handeln und der Zufriedenheit mit seinem persönlichen Wert setzten, und also im Bewußtsein der sittlichen Denkungsart mit einschlossen, worin sie aber durch die Stimme ihrer eigenen Natur hinreichend hätten widerlegt werden können.
Die Lehre des Christentums, wenn man sie auch noch nicht als Religionslehre betrachtet, gibt in diesem Stück einen Begriff des höchsten Guts (des Reichs Gottes), der allein der strengsten Foderung der praktischen Vernunft ein Genüge tut. Das moralische Gesetz ist heilig (unnachsichtlich) und fodert Heiligkeit der Sitten, obgleich alle moralische Vollkommenheit, zu welcher der Mensch gelangen kann, immer nur Tugend ist, d.h. gesetzmäßige Gesinnung aus Achtung fürs Gesetz, folglich Bewußtsein eines kontinuierlichen Hanges zur Übertretung, wenigstens Unlauterkeit, d.h. Beimischung vieler unechter (nicht moralischer) Bewegungsgründe zur Befolgung des Gesetzes, folglich eine mit Demut verbundene Selbstschätzung, und also in Ansehung der Heiligkeit, welche das christliche Gesetz fodert, nichts als Fortschritt ins Unendliche dem Geschöpf übrig läßt, eben daher aber auch dasselbe zur Hoffnung seiner ins Unendliche gehenden Fortdauer berechtigt. Der Wert einer dem moralischen Gesetz völlig angemessenen Gesinnung ist unendlich; weil alle mögliche Glückseligkeit, im Urteil eines weisen und alles vermögenden Austeilers derselben, keine andere Einschränkung hat, als den Mangel der Angemessenheit vernünftiger Wesen an ihrer Pflicht. Aber das moralische Gesetz für sich verheißt doch keine Glückseligkeit; denn diese ist, nach Begriffen von einer Naturordnung überhaupt, mit der Befolgung desselben nicht notwendig verbunden.
Die christliche Sittenlehre ergänzt nun diesen Mangel (des zweiten unentbehrlichen Bestandstücks des höchsten Guts) durch die Darstellung der Welt, darin vernünftige Wesen sich dem sittlichen Gesetz von ganzer Seele weihen, als eines Reichs Gottes, in welchem Natur und Sitten in eine, jeder von beiden für sich selbst fremde, Harmonie, durch einen heiligen Urheber kommen, der das abgeleitete höchste Gut möglich macht. Die Heiligkeit der Sitten wird ihnen in diesem Leben schon zur Richtschnur angewiesen, das dieser proportionierte Wohl aber, die Seligkeit, nur als in einer Ewigkeit erreichbar vorgestellt; weil jene immer das Urbild ihres Verhaltens in jedem Stande sein muss, und das Fortschreiten zu ihr schon in diesem Leben möglich und notwendig ist, diese aber in dieser Welt, unter dem Namen der Glückseligkeit, gar nicht erreicht werden kann (so viel auf unser Vermögen ankommt), und daher lediglich zum Gegenstand der Hoffnung gemacht wird. Diesem ungeachtet ist das christliche Prinzip der Moral selbst doch nicht theologisch (mithin Heteronomie), sondern Autonomie der reinen praktischen Vernunft für sich selbst, weil sie die Erkenntnis Gottes und seines Willens nicht zum Grunde dieser Gesetze, sondern nur der Gelangung zum höchsten Gute, unter der Bedingung der Befolgung derselben macht, und selbst die eigentliche Triebfeder zu Befolgung der ersteren nicht in den gewünschten Folgen derselben, sondern in der Vorstellung der Pflicht allein setzt, als in deren treuer Beobachtung die Würdigkeit des Erwerbs der letzteren allein besteht.
Auf solche Weise führt das moralische Gesetz durch den Begriff des höchsten Guts, als das Objekt und den Endzweck der reinen praktischen Vernunft, zur Religion, d.h. zur Erkenntnis aller Pflichten als göttliche Gebote, nicht als Sanktionen, d.h. willkürliche für sich selbst zufällige Verordnungen, eines fremden Willens, sondern als wesentliche (wesentlicher) Gesetze eines jeden freien Willens für sich selbst, die aber dennoch als Gebote des höchsten Wesens angesehen werden müssen, weil wir nur von einem moralisch-vollkommenen (heiligen und gütigen), zugleich auch allgewaltigen Willen das höchste Gut, welches zum Gegenstand unserer Bestrebung zu setzen uns das moralische Gesetz zur Pflicht macht, und also durch Übereinstimmung mit diesem Willen dazu zu gelangen hoffen können. Auch hier bleibt daher alles uneigennützig und bloß auf Pflicht gegründet; ohne dass Furcht oder Hoffnung als Triebfedern zum Grunde gelegt werden dürften, die, wenn sie zu Prinzipien werden, den ganzen moralischen Wert der Handlungen vernichten. Das moralische Gesetz gebietet, das höchste mögliche Gut in einer Welt mir zum letzten Gegenstand alles Verhaltens zu machen. Dieses aber kann ich nicht zu bewirken hoffen, als nur durch die Übereinstimmung meines Willens mit dem eines heiligen und gütigen Welturhebers, und, obgleich in dem Begriff des höchsten Guts, als dem eines Ganzen, worin die größte Glückseligkeit mit dem größten Maß sittlicher (in Geschöpfen möglicher) Vollkommenheit, als in der genauesten Proportion verbunden vorgestellt wird, meine eigene Glückseligkeit mit enthalten ist, so ist doch nicht sie, sondern das moralische Gesetz (welches vielmehr mein unbegrenztes Verlangen danach auf Bedingungen streng einschränkt) der Bestimmungsgrund des Willens, der zur Beförderung des höchsten Guts angewiesen wird. Daher ist auch die Moral nicht eigentlich die Lehre, wie wir uns glücklich machen, sondern wie wir der Glückseligkeit würdig werden sollen. Nur denn, wenn Religion dazu kommt, tritt auch die Hoffnung ein, der Glückseligkeit dereinst in dem Maße teilhaftig zu werden, als wir darauf bedacht gewesen, ihrer nicht unwürdig zu sein.
Würdig ist jemand des Besitzes einer Sache, oder eines Zustandes, wenn, dass er in diesem Besitz sei, mit dem höchsten Gut zusammenstimmt. Man kann jetzt leicht einsehen, dass alle Würdigkeit auf das sittliche Verhalten ankomme, weil dieses im Begriff des höchsten Guts die Bedingung des übrigen (was zum Zustande gehört), nämlich des Anteils an Glückseligkeit ausmacht. Nun folgt hieraus, dass man die Moral an sich niemals als Glückseligkeitslehre behandeln müsse, d.h. als eine Anweisung, der Glückseligkeit teilhaftig zu werden; denn sie hat es lediglich mit der Vernunftbedingung (conditio sine qua non) der letzteren, nicht mit einem Erwerbmittel derselben zu tun.
Wenn sie aber (die bloß Pflichten auferlegt, nicht eigennützigen Wünschen Maßregeln an die Hand gibt) vollständig vorgetragen wurden, alsdann allererst kann, nachdem der sich auf ein Gesetz gründende moralische Wunsch, das höchste Gut zu befördern (das Reich Gottes zu uns zu bringen), der vorher keiner eigennützigen Seele aufsteigen konnte, erweckt, und ihm zum Behuf der Schritt zur Religion geschehen ist, diese Sittenlehre auch Glückseligkeitslehre genannt werden, weil die Hoffnung dazu nur mit der Religion allererst anhebt. Auch kann man hieraus ersehen, dass, wenn man nach dem letzten Zweck Gottes in Schöpfung der Welt frägt, man nicht die Glückseligkeit der vernünftigen Wesen in ihr, sondern das höchste Gut nennen müsse, welches jenem Wunsche dieser Wesen noch eine Bedingung, nämlich die, der Glückseligkeit würdig zu sein d.h. die Sittlichkeit eben derselben vernünftigen Wesen, hinzufügt, die allein den Maßstab enthält, nach welchem sie allein der ersteren, durch die Hand eines weisen Urhebers, teilhaftig zu werden hoffen können. Denn, da Weisheit, theoretisch betrachtet, die Erkenntnis des höchsten Guts, und, praktisch, die Angemessenheit des Willens zum höchsten Gute bedeutet, so kann man einer höchsten selbständigen Weisheit nicht einen Zweck beilegen, der bloß auf Gütigkeit gegründet wäre. Denn dieser ihre Wirkung (in Ansehung der Glückseligkeit der vernünftigen Wesen) kann man nur unter den einschränkenden Bedingungen der Übereinstimmung mit der Heiligkeit seines Willens, als dem höchsten ursprünglichen Gute angemessen, denken.
Daher diejenige, welche den Zweck der Schöpfung in die Ehre Gottes (vorausgesetzt, dass man diese nicht anthropomorphistisch, als Neigung, gepriesen zu werden, denkt) setzten, wohl den besten Ausdruck getroffen haben. Denn nichts ehrt Gott mehr, als das, was das Schätzbarste in der Welt ist, die Achtung für sein Gebot, die Beobachtung der heiligen Pflicht, die uns sein Gesetz auferlegt, wenn seine herrliche Anstalt dazu kommt, eine solche schöne Ordnung mit angemessener Glückseligkeit zu krönen. Wenn ihn das letztere (auf menschliche Art zu reden) liebenswürdig macht, so ist er durch das erstere ein Gegenstand der Anbetung (Adoration). Selbst Menschen können sich durch Wohltun zwar Liebe, aber dadurch allein niemals Achtung erwerben, so dass die größte Wohltätigkeit ihnen nur dadurch Ehre macht, dass sie nach Würdigkeit ausgeübt wird.
Dass, in der Ordnung der Zwecke, der Mensch (mit ihm jedes vernünftige Wesen) Zweck an sich selbst sei, d.h. niemals bloß als Mittel von jemanden (selbst nicht von Gott), ohne zugleich hierbei selbst Zweck zu sein, könne gebraucht werden, dass also die Menschheit in unserer Person uns selbst heilig sein müsse, folgt nunmehr von selbst, weil er das Subjekt des moralischen Gesetzes, mithin dessen ist, was an sich heilig ist, um dessen willen und in Einstimmung mit welchem auch überhaupt nur etwas heilig genannt werden kann. Denn dieses moralische Gesetz gründet sich auf der Autonomie seines Willens, als eines freien Willens, der nach seinen allgemeinen Gesetzen notwendig zu demjenigen zugleich muss einstimmen können, welchem er sich unterwerfen soll.
Über die Postulate der reinen praktischen Vernunft überhaupt
Sie gehen alle vom Grundsätze der Moralität aus, der kein Postulat, sondern ein Gesetz ist, durch welches Vernunft mittelbar den Willen bestimmt, welcher Wille eben dadurch, dass er so bestimmt ist, als reiner Wille, diese notwendige Bedingungen der Befolgung seiner Vorschrift fordert. Diese Postulate sind nicht theoretische Dogmata, sondern Voraussetzungen in notwendig praktischer Rücksicht, erweitern also zwar das spekulative Erkenntnis, geben aber den Ideen der spekulativen Vernunft im allgemeinen (vermittelst ihrer Beziehung aufs Praktische) objektive Realität, und berechtigen sie zu Begriffen, deren Möglichkeit auch nur zu behaupten sie sich sonst nicht anmaßen könnte. Diese Postulate sind die der Unsterblichkeit, der Freiheit, positiv betrachtet (als der Kausalität eines Wesens, so fern es zur intelligibelen Welt gehört), und des Daseins Gottes. Das erste fließt aus der praktisch notwendigen Bedingung der Angemessenheit der Dauer zur Vollständigkeit der Erfüllung des moralischen Gesetzes; das zweite aus der notwendigen Voraussetzung der Unabhängigkeit von der Sinnenwelt und des Vermögens der Bestimmung seines Willens, nach dem Gesetz einer intelligibelen Welt, d.h. der Freiheit; das dritte aus der Notwendigkeit der Bedingung zu einer solchen intelligibelen Welt, um das höchste Gut zu sein, durch die Voraussetzung des höchsten selbständigen Guts, d.h. des Daseins Gottes.
Die durch die Achtung fürs moralische Gesetz notwendige Absicht aufs höchste Gut, und daraus fließende Voraussetzung der objektiven Realität desselben, führt also durch Postulate der praktischen Vernunft zu Begriffen, welche die spekulative Vernunft zwar als Aufgaben vortragen, sie aber nicht auflösen konnte.
Also 1. zu derjenigen, in deren Auflösung die letztere nichts, als Paralogismen begehen konnte (nämlich der Unsterblichkeit), weil es ihr am Merkmal der Beharrlichkeit fehlte, um den psychologischen Begriff eines letzten Subjekts, welcher der Seele im Selbstbewußtsein notwendig beigelegt wird, zur realen Vorstellung einer Substanz zu ergänzen, welches die praktische Vernunft, durch das Postulat, einer zur Angemessenheit mit dem moralischen Gesetz im höchsten Gut, als dem ganzen Zweck der praktischen Vernunft, erforderlichen Dauer, ausrichtet.
2.Führt sie zu dem, wovon die spekulative Vernunft nichts als Antinomie enthielt, deren Auflösung sie nur auf einem problematisch zwar denkbaren, aber seiner objektiven Realität nach für sie nicht erweislichen und bestimmbaren Begriff gründen konnte, nämlich die kosmologische Idee einer intelligibelen Welt und das Bewußtsein unseres Daseins in derselben, vermittelst des Postulats der Freiheit (deren Realität sie durch das moralische Gesetz darlegt, und mit ihm zugleich das Gesetz einer intelligibelen Welt, worauf die spekulative nur hinweisen, ihren Begriff aber nicht bestimmen konnte).
3.Verschafft sie dem, was spekulative Vernunft zwar denken, aber als bloßes transzendentales Ideal unbestimmt lassen musste, dem theologischen Begriff des Urwesens, Bedeutung (in praktischer Absicht, d.h. als einer Bedingung der Möglichkeit des Objekts eines durch jenes Gesetz bestimmten Willens), als dem obersten Prinzip des höchsten Guts in einer intelligibelen Welt, durch gewalthabende moralische Gesetzgebung in derselben.
Wird nun aber unsere Erkenntnis auf solche Art durch reine praktische Vernunft wirklich erweitert, und ist das, was für die spekulative transzendent war, in der praktischen immanent? Allerdings, aber nur in praktischer Absicht. Denn wir erkennen zwar dadurch weder unserer Seele Natur, noch die intelligibele Welt, noch das höchste Wesen, nach dem, was sie an sich selbst sind, sondern haben nur die Begriffe von ihnen im praktischen Begriff des höchsten Guts vereinigt, als dem Objekte unseres Willens, und völlig a priori, durch reine Vernunft, aber nur vermittelst des moralischen Gesetzes, und auch bloß in Beziehung auf dasselbe, in Ansehung des Objektes, das es gebietet.
Wie aber auch nur die Freiheit möglich sei, und wie man sich diese Art von Kausalität theoretisch und positiv vorzustellen habe, wird dadurch nicht eingesehen, sondern nur, dass eine solche sei, durchs moralische Gesetz und zu dessen Behuf postuliert. So ist es auch mit den übrigen Ideen bewandt, die nach ihrer Möglichkeit kein menschlicher Verstand jemals ergründen, aber auch, dass sie nicht wahre Begriffe sind, keine Sophisterei der Überzeugung, selbst des gemeinsten Menschen, jemals entreißen wird.
VII. Wie eine Erweiterung der reinen Vernunft, in praktischer Absicht, ohne damit ihre Erkenntnis, als spekulativ, zugleich zu erweitern, zu denken möglich sei?
Wir wollen diese Frage, um nicht zu abstrakt zu werden, sofort in Anwendung auf den vorliegenden Fall beantworten. Um ein reines Erkenntnis praktisch zu erweitern, muss eine Absicht a priori gegeben sein, d.h. ein Zweck, als Objekt (des Willens), welches, unabhängig von allen theologischen Grundsätzen, durch einen den Willen unmittelbar bestimmenden (kategorischen) Imperativ, als praktisch-notwendig vorgestellt wird, und das ist hier das höchste Gut. Dieses ist aber nicht möglichohne drei theoretische Begriffe (für die sich, weil sie bloße reine Vernunftbegriffe sind, keine korrespondierende Anschauung, mithin, auf dem theoretischen Wege, keine objektive Realität finden lässt) vorauszusetzen, nämlich Freiheit, Unsterblichkeit und Gott. Also wird durchs praktische Gesetz, welches die Existenz des höchsten in einer Welt möglichen Guts gebietet, die Möglichkeit jener Objekte der reinen spekulativen Vernunft, die objektive Realität, welche diese ihnen nicht sichern konnte, postuliert; wodurch denn die theoretische Erkenntnis der reinen Vernunft allerdings einen Zuwachs bekommt, der aber bloß darin besteht, dass jene für sie sonst problematischen (bloß denkbare) Begriffe jetzt assertorisch für solche erklärt werden, denen wirklich Objekte zukommen, weil praktische Vernunft die Existenz derselben zur Möglichkeit ihres, und zwar praktisch-schlechthin notwendigen, Objekts des höchsten Guts unvermeidlich bedarf, und die theoretische dadurch berechtigt wird, sie vorauszusetzen. Diese Erweiterung der theoretischen Vernunft ist aber keine Erweiterung der Spekulation, d.h. um in theoretischer Absicht nunmehr einen positiven Gebrauch davon zu machen. Denn da nichts weiter durch praktische Vernunft hierbei geleistet wurde, als dass jene Begriffe real sind, und wirklich ihre (möglichen) Objekte haben, dabei aber uns nichts von Anschauung derselben gegeben wird (welches auch nicht gefedert werden kann), so ist kein synthetischer Satz durch diese eingeräumte Realität derselben möglich. Folglich hilft uns diese Eröffnung nicht im Mindesten in spekulativer Absicht, wohl aber in Ansehung des praktischen Gebrauchs der reinen Vernunft, zur Erweiterung dieses unseres Erkenntnisses.
Die obigen drei Ideen der spekulativen Vernunft sind an sich noch keine Erkenntnisse; doch sind es (transzendente) Gedanken, in denen nichts Unmögliches ist. Nun bekommen sie durch ein apodiktisches praktisches Gesetz, als notwendige Bedingungen der Möglichkeit dessen, was dieses sich zum Objekt zu machen gebietet, objektive Realität, d.h. wir werden durch jenes angewiesen, dass sie Objekte haben, ohne doch, wie sich ihr Begriff auf ein Objekt bezieht, anzeigen zu können, und das ist auch noch nicht Erkenntnis dieser Objekte; denn man kann dadurch gar nichts über sie synthetisch urteilen, noch die Anwendung derselben theoretisch bestimmen, mithin von ihnen gar keinen theoretischen Gebrauch der Vernunft machen, als worin eigentlich alle spekulative Erkenntnis derselben besteht. Aber dennoch ward das theoretische Erkenntnis, zwar nicht dieser Objekte, aber der Vernunft überhaupt, dadurch so fern erweitert, dass durch die praktischen Postulate jenen Ideen doch Objekte gegeben wurden, indem ein bloß problematischer Gedanke dadurch allererst objektive Realität bekam. Also war es keine Erweiterung der Erkenntnis von gegebenen übersinnlichen Gegenständen, aber doch eine Erweiterung der theoretischen Vernunft und der Erkenntnis derselben in Ansehung des Übersinnlichen überhaupt, so fern als sie genötigt wurde, dass es solche Gegenstände gebe, einzuräumen, ohne sie doch näher zu bestimmen, mithin dieses Erkenntnis von den Objekten (die ihr nunmehr aus praktischem Grund, und auch nur zum praktischen Gebrauch, gegeben worden) selbst erweitern zu können, welchen Zuwachs also die reine theoretische Vernunft, für die alle jene Ideen transzendent und ohne Objekt sind, lediglich ihrem reinen praktischen Vermögen zu verdanken hat. Hier werden sie immanent und konstitutiv, indem sie Gründe der Möglichkeit sind, das notwendige Objekt der reinen praktischen Vernunft (das höchste Gut) wirklich zu machen, da sie, ohne dies, transzendent und bloß regulative Prinzipien der spekulativen Vernunft sind, die ihr nicht ein neues Objekt über die Erfahrung hinaus anzunehmen, sondern nur ihren Gebrauch in der Erfahrung der Vollständigkeit zu nähern, auferlegen. Ist aber die Vernunft einmal im Besitz dieses Zuwachses, so wird sie, als spekulative Vernunft (eigentlich nur zur Sicherung ihres praktischen Gebrauchs), negativ, d.h. nicht erweiternd, sondern läuternd, mit jenen Ideen zu Werke gehen, um einerseits den Anthropomorphismus als den Quell der Superstition, oder scheinbare Erweiterung jener Begriffe durch vermeinte Erfahrung, andererseits den Fanatismus, der sie durch übersinnliche Anschauung oder dergleichen Gefühle verspricht, abzuhalten; welches alles Hindernisse des praktischen Gebrauchs der reinen Vernunft sind, deren Abwehrung also zu der Erweiterung unserer Erkenntnis in praktischer Absicht allerdings gehört, oder dass es dieser widerspricht, zugleich zu gestehen, dass die Vernunft in spekulativer Absicht dadurch im Mindesten nichts gewonnen habe.
Zu jedem Gebrauch der Vernunft in Ansehung eines Gegenstandes werden reine Verstandesbegriffe (Kategorien) erfordert, ohne die kein Gegenstand gedacht werden kann. Diese können zum theoretischen Gebrauch der Vernunft, d.h. zu dergleichen Erkenntnis nur angewandt werden, sofern ihnen zugleich Anschauung (die jederzeit sinnlich ist) untergelegt wird, und also bloß, um durch sie ein Objekt möglicher Erfahrung vorzustellen. Nun sind hier aber Ideen der Vernunft, die in gar keiner Erfahrung gegeben werden können, das, was ich durch Kategorien denken müsste, um es zu erkennen. Allein es ist hier auch nicht um die theoretische Erkenntnis der Objekte dieser Ideen, sondern nur darum, dass sie überhaupt Objekte haben, zu tun. Diese Realität verschafft reine praktische Vernunft, und hierbei hat die theoretische Vernunft nichts weiter zu tun, als jene Objekte durch Kategorien bloß zu denken, welches, wie wir sonst deutlich gewiesen haben, ganz wohl, ohne Anschauung (weder sinnliche, noch übersinnliche) zu bedürfen, angeht, weil die Kategorien im reinen Verstand unabhängig und vor aller Anschauung, lediglich als dem Vermögen zu denken, ihren Sitz und Ursprung haben, und sie immer nur ein Objekt überhaupt bedeuten, auf welche Art es uns auch immer gegeben werden mag.
Nun ist den Kategorien, sofern sie auf jene Ideen angewandt werden sollen, zwar kein Objekt in der Anschauung zu geben möglich; es ist ihnen aber doch, dass ein solches wirklich sei, mithin die Kategorie, als eine bloße Gedankenform, hier nicht leer sei, sondern Bedeutung habe, durch ein Objekt, welches die praktische Vernunft im Begriff des höchsten Guts ungezweifelt darbietet, die Realität der Begriffe, die zum Behuf der Möglichkeit des höchsten Guts gehören, hinreichend gesichert, ohne gleichwohl durch diesen Zuwachs die mindeste Erweiterung des Erkenntnisses nach theoretischen Grundsätzen zu bewirken.
Wenn, nächstdem, diese Ideen von Gott, einer intelligiblen Welt (dem Reiche Gottes) und der Unsterblichkeit durch Prädikate bestimmt werten, die von unserer eigenen Natur hergenommen sind, so darf man diese Bestimmung weder als Versinnlichung jener reinen Vernunftideen (Anthropomorphismen), noch als überschwängliches Erkenntnis übersinnlicher Gegenstände ansehen; denn diese Prädikate sind keine andere als Verstand und Wille, und zwar so im Verhältniss gegeneinander betrachtet, als sie im moralischen Gesetz gedacht werden müssen, also nur, so weit von ihnen ein reiner praktischer Gebrauch gemacht wird. Von allem übrigen, was diesen Begriffen psychologisch anhängt, d.h. so fern wir diese unsere Vermögen in ihrer Ausübung empirisch beobachten (z.B. dass der Verstand des Menschen diskursiv ist, seine Vorstellungen also Gedanken, nicht Anschauungen sind, dass diese in der Zeit aufeinander folgen, dass sein Wille immer mit einer Abhängigkeit der Zufriedenheit von der Existenz seines Gegenstandes behaftet ist, usw., welches im höchsten Wesen so nicht sein kann), wird alsdann abstrahiert, und so bleibt von den Begriffen, durch die wir uns ein reines Verstandeswesen denken, nichts mehr übrig, als gerade zur Möglichkeit erforderlich ist, sich ein moralisch Gesetz zu denken, mithin zwar ein Erkenntnis Gottes, aber nur in praktischer Beziehung, wodurch, wenn wir den Versuch machen, es zu einem theoretischen zu erweitern, wir einen Verstand desselben bekommen, der nicht denkt, sondern anschaut, einen Willen, der auf Gegenstände gerichtet ist, von deren Existenz seine Zufriedenheit nicht im mindesten abhängt (ich will nicht einmal der transzendentalen Prädikate erwähnen, als z.B. eine Größe der Existenz, d.h. Dauer, die aber nicht in der Zeit, als dem einzigen uns möglichen Mittel, uns Dasein als Größe vorzustellen, stattfindet), lauter Eigenschaften, von denen wir uns gar keinen Begriff, zum Erkenntniss des Gegenstandes tauglich, machen können, und dadurch belehrt werden, dass sie niemals zu einer Theorie von übersinnlichen Wesen gebraucht werden können, und also, auf dieser Seite, ein spekulatives Erkenntnis zu gründen gar nicht vermögen, sondern ihren Gebrauch lediglich auf die Ausübung des moralischen Gesetzes einschränken. Dieses Letztere ist so augenscheinlich, und kann so klar durch die Tat bewiesen werden, dass man getrost alle vermeinte natürliche Gottesgelehrte (ein wunderlicher Name) auffordern kann, auch nur eine diesen ihren Gegenstand (über die bloß ontologischen Prädikate hinaus) bestimmende Eigenschaft, etwa des Verstandes oder des Willens, zu nennen, an der man nicht unwidersprechlich dartun könnte, dass, wenn man alles Anthropomorphistische davon absondert, uns nur das bloße Wort übrig bleibe, ohne damit den mindesten Begriff verbinden zu können, dadurch eine Erweiterung der theoretischen Erkenntnis gehofft werden dürfte.
In Ansehung des Praktischen aber bleibt uns von den Eigenschaften eines Verstandes und Willens doch noch der Begriff eines Verhältnisses übrig, welchem das praktische Gesetz (das gerade dieses Verhältnis des Verstandes zum Willen a priori bestimmt) objektive Realität verschafft. Ist dieses nun einmal geschehen, so wird dem Begriff des Objekts eines moralisch bestimmten Willens (dem des höchsten Guts) und mit ihm den Bedingungen seiner Möglichkeit, den Ideen von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, auch Realität, aber immer nur in Beziehung auf die Ausübung des moralischen Gesetzes (zu keinem spekulativen Behuf), gegeben.
Nach diesen Erinnerungen ist nun auch die Beantwortung der wichtigen Frage leicht zu finden: Ob der Begriff von Gott ein zur Physik (mithin auch zur Metaphysik, als die nur die reinen Prinzipien a priori der ersteren in allgemeiner Bedeutung enthält) oder ein zur Moral gehöriger Begriff sei. Natureinrichtungen, oder deren Veränderung zu erklären, wenn man da zu Gott, als dem Urheber aller Dinge, seine Zuflucht nimmt, ist wenigstens keine physische Erklärung, und überall ein Geständnis, man sei mit seiner Philosophie zu Ende; weil man genötigt ist, etwas, wovon man sonst für sich keinen Begriff hat, anzunehmen, um sich von der Möglichkeit dessen, was man vor Augen sieht, einen Begriff machen zu können. Durch Metaphysik aber von der Kenntnis dieser Welt zum Begriff von Gott und dem Beweise seiner Existenz durch sichere Schlüsse zu gelangen, ist darum unmöglich, weil wir diese Welt als das vollkommenste mögliche Ganze, mithin, zu diesem Behuf, alle mögliche Welten (um sie mit dieser vergleichen zu können) erkennen, mithin allwissend sein müssten, um zu sagen, dass sie nur durch einen Gott (wie wir uns diesen Begriff denken müssen) möglich war. Vollends aber die Existenz dieses Wesens aus bloßen Begriffen zu erkennen, ist schlechterdings unmöglich, weil ein jeder Existentialsatz, d.h. der, so von einem Wesen, von dem ich mir einen Begriff mache, sagt, dass es existiere, ein synthetischer Satz ist, d.h. ein solcher, dadurch ich über jenen Begriff hinausgehe und mehr von ihm sage, als im Begriff gedacht war, nämlich dass diesem Begriff im Verstand noch ein Gegenstand außer dem Verstand korrespondierend gesetzt sei, welches offenbar unmöglich ist durch irgendeinen Schluss herauszubringen. Also bleibt nur ein einziges Verfahren für die Vernunft übrig, zu diesem Erkenntnisse zu gelangen, da sie nämlich, als reine Vernunft, von dem obersten Prinzip ihres reinen praktischen Gebrauchs ausgehend (indem dieser ohnedem bloß auf die Existenz von etwas, als Folge der Vernunft, gerichtet ist), ihr Objekt bestimmt. Und da zeigt sich, nicht allein in ihrer unvermeidlichen Aufgabe, nämlich der notwendigen Richtung des Willens auf das höchste Gut, die Notwendigkeit, ein solches Urwesen, in Beziehung auf die Möglichkeit dieses Guten in der Welt, anzunehmen, sondern, was das Merkwürdigste ist, etwas, was dem Fortgange der Vernunft auf dem Naturwege ganz mangelte, nämlich ein genau bestimmter Begriff dieses Urwesens.
Da wir diese Welt nur zu einem kleinen Teile kennen, noch weniger sie mit allen möglichen Welten vergleichen können, so können wir von ihrer Ordnung, Zweckmäßigkeit und Größe wohl auf einen weisen, gütigen, mächtigen etc. Urheber derselben schließen, aber nicht auf seine Allwissenheit, Allgütigkeit, Allmacht, usw. Man kann auch gar wohl einräumen, dass man diesen unvermeidlichen Mangel durch eine erlaubte ganz vernünftige Hypothese zu ergänzen wohl befugt sei; dass nämlich, wenn in so viel Stücken, als sich unserer näheren Kenntnis darbieten, Weisheit, Gütigkeit etc. hervorleuchtet, in allen übrigen es ebenso sein werde, und es also vernünftig sei, dem Welturheber alle mögliche Vollkommenheit beizulegen; aber das sind keine Schlüsse, wodurch wir uns auf unsere Einsicht etwas dünken, sondern nur Befugnisse, die man uns nachsehen kann, und doch noch einer anderweitigen Empfehlung bedürfen, um davon Gebrauch zu machen. Der Begriff von Gott bleibt also auf dem empirischen Wege (der Physik) immer ein nicht genau bestimmter Begriff von der Vollkommenheit des ersten Wesens, um ihn dem Begriff einer Gottheit für angemessen zu halten (mit der Metaphysik aber in ihrem transzendentalen Teile ist gar nichts auszurichten).
Ich versuche nun, diesen Begriff an das Objekt der praktischen Vernunft zu halten, und da finde ich, dass der moralische Grundsatz ihn nur als möglich, unter Voraussetzung eines Welturhebers von höchster Vollkommenheit, zulasse. Er muss allwissend sein, um mein Verhalten bis zum Innersten meiner Gesinnung in allen möglichen Fällen und in alle Zukunft zu erkennen; allmächtig, um ihm die angemessenen Folgen zu erteilen; ebenso allgegenwärtig, ewig, usw. Mithin bestimmt das moralische Gesetz durch den Begriff des höchsten Guts, als Gegenstand einer reinen praktischen Vernunft, den Begriff des Urwesens als höchsten Wesens, welches der physische (und höher fortgesetzt der metaphysische), mithin der ganze spekulative Gang der Vernunft nicht bewirken konnte. Also ist der Begriff von Gott ein ursprünglich nicht zur Physik, d.h. für die spekulative Vernunft, sondern zur Moral gehöriger Begriff, und eben das kann man auch von den übrigen Vernunftbegriffen sagen, von denen wir, als Postulaten derselben in ihrem praktischen Gebrauch, oben gehandelt haben.
Wenn man in der Geschichte der griechischen Philosophie über den Anaxagoras hinaus keine deutlichen Spuren einer reinen Vernunfttheologie antrifft, so ist der Grund nicht darin gelegen, dass es den älteren Philosophen an Verstand und Einsicht fehlte, um durch den Weg der Spekulation, wenigstens mit Beihilfe einer ganz vernünftigen Hypothese, sich dahin zu erheben; was konnte leichter, was natürlicher sein, als der sich von selbst jedermann darbietende Gedanke, statt unbestimmter Grade der Vollkommenheit verschiedener Weltursachen, eine einzige vernünftige anzunehmen, die alle Vollkommenheit hat? Aber die Übel in der Welt schienen ihnen viel zu wichtige Einwürfe zu sein, um zu einer solchen Hypothese sich für berechtigt zu halten. Mithin zeigten sie darin eben Verstand und Einsicht, dass sie sich jene nicht erlaubten, und vielmehr in den Naturursachen herum suchten, ob sie unter ihnen nicht die zu Urwesen erforderliche Beschaffenheit und Vermögen antreffen möchten. Aber nachdem dieses scharfsinnige Volk so weit in Nachforschungen fortgerückt war, selbst sittliche Gegenstände, darüber andere Völker niemals mehr als geschwatzt haben, philosophisch zu behandeln, da fanden sie allererst ein neues Bedürfnis, nämlich ein praktisches, welches nicht ermangelte, ihnen den Begriff des Urwesens bestimmt anzugeben, wobei die spekulative Vernunft das Zusehen hatte, höchstens noch das Verdienst, einen Begriff, der nicht auf ihrem Boden erwachsen war, auszuschmücken, und mit einem Gefolge von Bestätigungen aus der Naturbetrachtung, die nun allererst hervortraten, wohl nicht das Ansehen desselben (welches schon gegründet war), sondern vielmehr nur das Gepränge mit vermeinter theoretischer Vernunfteinsicht zu befördern.
Aus diesen Erinnerungen wird der Leser der Kritik der reinen spekulativen Vernunft sich vollkommen überzeugen, wie höchstnötig, wie ersprießlich für Theologie und Einwürfe zu sein, um zu einer solchen Hypothese sich für berechtigt zu halten. Mithin zeigten sie darin eben Verstand und Einsicht, dass sie sich jene nicht erlaubten, und vielmehr in den Naturursachen herum suchten, ob sie unter ihnen nicht die zu Urwesen erforderliche Beschaffenheit und Vermögen antreffen möchten. Aber nachdem dieses scharfsinnige Volk so weit in Nachforschungen fortgerückt war, selbst sittliche Gegenstände, darüber andere Völker niemals mehr als geschwatzt haben, philosophisch zu behandeln, da fanden sie allererst ein neues Bedürfnis, nämlich ein praktisches, welches nicht ermangelte, ihnen den Begriff des Urwesens bestimmt anzugeben, wobei die spekulative Vernunft das Zusehen hatte, höchstens noch das Verdienst, einen Begriff, der nicht auf ihrem Boden erwachsen war, auszuschmücken, und mit einem Gefolge von Bestätigungen aus der Naturbetrachtung, die nun allererst hervortraten, wohl nicht das Ansehen desselben (welches schon gegründet war), sondern vielmehr nur das Gepränge mit vermeinter theoretischer Vernunfteinsicht zu befördern.
Aus diesen Erinnerungen wird der Leser der Kritik der reinen spekulativen Vernunft sich vollkommen überzeugen, wie höchstnötig, wie ersprießlich für Theologie und Moral, jene mühsame Deduktion der Kategorien war. Denn dadurch allein kann verhütet werden, sie, wenn man sie im reinen Verstand setzt, mit Plato, für angeboren zu halten, und darauf überschwengliche Anmaßungen mit Theorien des Übersinnlichen, wovon man kein Ende absieht, zu gründen, dadurch aber die Theologie zur Zauberlaterne von Hirngespinsten zu machen; wenn man sie aber für erworben hält, zu verhüten, dass man nicht, mit Epikur, allen und jeden Gebrauch derselben, selbst den in praktischer Absicht, bloß auf Gegenstände und Bestimmungsgründe der Sinne einschränke. Nun aber, nachdem die Kritik in jener Deduktion erstlich bewies, dass sie nicht empirischen Ursprungs sein, sondern a priori im reinen Verstand ihren Sitz und Quelle haben; zweitens auch, dass, da sie auf Gegenstände überhaupt, unabhängig von ihrer Anschauung, bezogen werden, sie zwar nur in Anwendung auf empirische Gegenstände theoretisches Erkenntnis zu Stande bringen, aber doch auch, auf einen durch reine praktische Vernunft gegebenen Gegenstand angewandt, zum bestimmten Denken des Übersinnlichen dienen, jedoch nur, sofern dieses bloß durch solche Prädikate bestimmt wird, die notwendig zur reinen a priori gegebenen praktischen Absicht und deren Möglichkeit gehören. Spekulative Einschränkung der reinen Vernunft und praktische Erweiterung derselben bringen dieselbe allererst in dasjenige Verhältnis der Gleichheit, worin Vernunft überhaupt zweckmäßig gebraucht werden kann, und dieses Beispiel beweist besser, als sonst eines, dass der Weg zur Weisheit, wenn er gesichert und nicht ungangbar oder irreleitend werden soll, bei uns Menschen unvermeidlich durch die Wissenschaft durchgehen müsse, wovon man aber, dass diese zu jenem Ziele führe, nur nach Vollendung derselben überzeugt werden kann.
VIII. Vom Fürwahrhalten aus einem Bedürfnisse der reinen Vernunft
Ein Bedürfnis der reinen Vernunft in ihrem spekulativen Gebrauch führt nur auf Hypothesen, das der reinen praktischen Vernunft aber zu Postulaten; denn im ersteren Fall steige ich vom Abgeleiteten so hoch hinauf in der Reihe der Gründe, wie ich will, und bedarf eines Ungrundes, nicht um jenem Abgeleiteten (z.B. der Kausalverbindung der Dinge und Veränderungen in der Welt) objektive Realität zu geben, sondern nur um meine forschende Vernunft in Ansehung desselben vollständig zu befriedigen. So sehe ich Ordnung und Zweckmäßigkeit in der Natur vor mir, und bedarf nicht, um mich von deren Wirklichkeit zu versichern, zur Spekulation zu schreiten, sondern nur, um sie zu erklären, eine Gottheit, als deren Ursache, vorauszusetzen; da denn, weil von einer Wirkung der Schluss auf eine bestimmte, vornehmlich so genau und so vollständig bestimmte Ursache, als wir an Gott zu denken haben, immer unsicher und misslich ist, eine solche Voraussetzung nicht weitergebracht werden kann, als zu dem Grad der, für uns Menschen, allervernünftigsten Meinung.
Dagegen ist ein Bedürfnis der reinen praktischen Vernunft, auf einer Pflicht gegründet, etwas (das höchste Gut) zum Gegenstand meines Willens zu machen, um es nach allen meinen Kräften zu befördern; wobei ich aber die Möglichkeit desselben, mithin auch die Bedingungen dazu, nämlich Gott, Freiheit und Unsterblichkeit voraussetzen muss, weil ich diese durch meine spekulative Vernunft nicht beweisen, obgleich auch nicht widerlegen kann. Diese Pflicht gründet sich auf einem, freilich von diesen letzteren Voraussetzungen ganz unabhängigen, für sich selbst apodiktisch gewissen, nämlich dem moralischen, Gesetz, und ist, so fern, keiner anderweitigen Unterstützung durch theoretische Meinung von der inneren Beschaffenheit der Dinge, der geheimen Abzweckung der Weltordnung, oder eines ihr vorstehenden Regierers, bedürftig, um uns auf das vollkommenste zu unbedingt-gesetzmäßigen Handlungen zu verbinden. Aber der subjektive Effekt dieses Gesetzes, nämlich die ihm angemessene und durch dasselbe auch notwendige Gesinnung, das praktisch mögliche höchste Gut zu befördern, setzt doch wenigstens voraus, dass das Letztere möglich sei, widrigenfalls es praktisch-unmöglich wäre, dem Objekt eines Begriffes nachzustreben, welcher im Grunde leer und ohne Objekt wäre.
Nun betreffen obige Postulate nur die physische oder metaphysische, mit einem Wort, in der Natur der Dinge liegenden Bedingungen der Möglichkeit des höchsten Guts, aber nicht zum Behuf einer beliebigen spekulativen Absicht, sondern eines praktisch notwendigen Zwecks des reinen Vernunftwillens, der hier nicht wählt, sondern einem unnachlässlichen Vernunftgebot gehorcht, welches seinen Grund, objektiv, in der Beschaffenheit der Dinge hat, so wie sie durch reine Vernunft allgemein beurteilt werden müssen, und gründet sich nicht etwa auf Neigung, die zum Behuf dessen, was wir aus bloß subjektiven Gründen wünschen, sofort die Mittel dazu als möglich, oder den Gegenstand wohl gar als wirklich, anzunehmen keineswegs berechtigt ist. Also ist dieses ein Bedürfnis in schlechterdings notwendiger Absicht, und rechtfertigt seine Voraussetzung nicht bloß als erlaubte Hypothese, sondern als Postulat in praktischer Absicht; und, zugestanden, dass das reine moralische Gesetz jedermann, als Gebot (nicht als Klugheitsregel), unnachlässlich verbinde, darf der Rechtschaffene wohl sagen, ich will, dass ein Gott, dass mein Dasein in dieser Welt, auch außer der Naturverknüpfung, noch ein Dasein in einer reinen Verstandeswelt, endlich auch dass meine Dauer endlos sei, ich beharre darauf und lasse mir diesen Glauben nicht nehmen; denn dieses ist das Einzige, wo mein Interesse, weil ich von demselben nichts nachlassen darf, mein Urteil unvermeidlich bestimmt, ohne auf Vernünfteleien zu achten, so wenig ich auch darauf zu antworten oder ihnen scheinbarere entgegen zu stellen im Stande sein möchte.
Um bei dem Gebrauch eines noch so ungewohnten Begriffs als der eines reinen praktischen Vernunftglaubens ist, Missdeutungen zu verhüten, sei mir erlaubt, noch eine Anmerkung hinzuzufügen. Es sollte fast scheinen, als ob dieser Vernunftglaube hier selbst als Gebot angekündigt werde, nämlich das höchste Gut für möglich anzunehmen. Ein Glaube aber, der geboten wird, ist ein Unding. Man erinnere sich aber der obigen Auseinandersetzung dessen, was im Begriff des höchsten Guts anzunehmen verlangt wird, und wird man inne werden, dass diese Möglichkeit anzunehmen gar nicht geboten werden dürfe, und keine praktische Gesinnungen fordere, sie einzuräumen, sondern dass spekulative Vernunft sie ohne Gesuch zugeben müsse; denn dass eine, dem moralischen Gesetz angemessene, Würdigkeit der vernünftigen Wesen in der Welt, glücklich zu sein, mit einem dieser proportionierten Besitze dieser Glückseligkeit in Verbindung, an sich unmöglich sei, kann doch niemand behaupten wollen.
Nun gibt uns in Ansehung des ersten Stücks des höchsten Guts, nämlich was die Sittlichkeit betrifft, das moralische Gesetz bloß ein Gebot, und, die Möglichkeit jenes Bestandstücks zu bezweifeln, wäre ebenso viel, als das moralische Gesetz selbst in Zweifel ziehen. Was aber das zweite Stück jenes Objekts, nämlich die jener Würdigkeit durchgängig angemessene Glückseligkeit, betrifft, so ist zwar die Möglichkeit derselben überhaupt einzuräumen gar nicht eines Gebots bedürftig, denn die theoretische Vernunft hat selbst nichts dawider, nur die Art, wie wir uns eine solche Harmonie der Naturgesetze mit denen der Freiheit denken sollen, hat etwas an sich, in Ansehung dessen uns eine Wahl zukommt, weil theoretische Vernunft hierüber nichts mit apodiktischer Gewissheit entscheidet, und, in Ansehung dieser, kann es ein moralisches Interesse geben, das den Ausschlag gibt.
Oben hatte ich gesagt, dass, nach einem bloßen Naturgang in der Welt, die genau dem sittlichen Wert angemessene Glückseligkeit nicht zu erwarten und für unmöglich zu halten sei, und dass also die Möglichkeit des höchsten Guts, von dieser Seite, nur unter Voraussetzung eines moralischen Welturhebers könne eingeräumt werden. Ich hielt mit Vorbedacht mit der Einschränkung dieses Urteils auf die subjektiven Bedingungen unserer Vernunft zurück, um nur dann allererst, wenn die Art ihres Fürwahrhaltens näher bestimmt werden sollte, davon Gebrauch zu machen. In der Tat ist die genannte Unmöglichkeit bloß subjektiv, d.h. unsere Vernunft findet es ihr unmöglich, sich einen so genau angemessenen und durchgängig zweckmäßigen Zusammenhang zwischen zwei nach so verschiedenen Gesetzen sich eräugnenden Weltbegebenheiten, nach einem bloßen Naturlaufe, begreiflich zu machen; ob sie zwar, wie bei allem, was sonst in der Natur Zweckmäßiges ist, die Unmöglichkeit desselben, nach allgemeinen Naturgesetzen, doch auch nicht beweisen, d.h. aus objektiven Gründen hinreichend dartun kann.
Allein jetzt kommt ein Entscheidungsgrund von anderer Art ins Spiel, um im Schwanken der spekulativen Vernunft den Ausschlag zu geben. Das Gebot, das höchste Gut zu befördern, ist objektiv (in der praktischen Vernunft), die Möglichkeit desselben überhaupt gleichfalls objektiv (in der theoretischen Vernunft, die nichts dawider hat) gegründet. Allein die Art, wie wir uns diese Möglichkeit vorstellen sollen, ob nach allgemeinen Naturgesetzen, ohne einen der Natur vorstehenden weisen Urheber, oder nur unter dessen Voraussetzung, das kann die Vernunft objektiv nicht entscheiden. Hier tritt nun eine subjektive Bedingung der Vernunft ein, die Einzige ihr theoretisch mögliche, zugleich der Moralität (die unter einem objektiven Gesetz der Vernunft steht) allein zuträgliche Art, sich die genaue Zusammenstimmung des Reichs der Natur mit dem Reich der Sitten, als Bedingung der Möglichkeit des höchsten Guts, zu denken.
Da nun die Beförderung desselben, und also die Voraussetzung seiner Möglichkeit, objektiv (aber nur der praktischen Vernunft zu Folge) notwendig ist, zugleich aber die Art, auf welche Weise wir es uns als möglich denken wollen, in unserer Wahl steht, in welcher aber ein freies Interesse der reinen praktischen Vernunft für die Annehmung eines weisen Welturhebers entscheidet, so ist das Prinzip, was unser Urteil hierin bestimmt, zwar subjektiv, als Bedürfnis, aber auch zugleich als Beförderungsmittel dessen, was objektiv (praktisch) notwendig ist, der Grund einer Maxime des Fürwahrhaltens in moralischer Absicht, d.h. ein reiner praktischer Vernunftglaube. Dieser ist also nicht geboten, sondern, als freiwillige, zur moralischen (gebotenen) Absicht zuträgliche, überdem noch mit dem theoretischen Bedürfniss der Vernunft einstimmige Bestimmung unseres Urteils, jene Existenz anzunehmen und dem Vernunftgebrauch ferner zum Grunde zu legen, selbst aus der moralischen Gesinnung entsprungen; kann also öfters selbst bei Wohlgesinnten bisweilen ins Schwanken niemals aber in Unglauben geraten.
1.Von der der praktischen Bestimmung des Menschen weislich angemessenen Proportion seiner Erkenntnisvermögen
Wenn die menschliche Natur zum höchsten Gute zu streben bestimmt ist, so muss auch das Maß ihrer Erkenntnisvermögen, vornehmlich ihr Verhältnis untereinander, als zu diesem Zweck schicklich, angenommen werden. Nun beweist aber die Kritik der reinen spekulativen Vernunft die größte Unzulänglichkeit derselben, um die wichtigsten Aufgaben, die ihr vorgelegt werden, dem Zweck angemessen aufzulösen, ob sie zwar die natürlichen und nicht zu übersehenden Winke eben derselben Vernunft, imgleichen die großen Schritte, die sie tun kann, nicht verkennt, um sich diesem großen Ziel, das ihr ausgesteckt ist, zu nähern, aber doch, ohne es jemals für sich selbst, sogar mit Beihilfe der größten Naturkenntnis, zu erreichen. Also scheint die Natur hier uns nur stiefmütterlich mit einem zu unserem Zweck benötigten Vermögen versorgt zu haben.
Gesetzt nun, sie wäre hierin unserem Wunsch willfährig gewesen, und hätte uns diejenige Einsichtsfähigkeit oder Erleuchtung erteilt, die wir gerne besitzen möchten, oder in deren Besitz einige wohl gar wähnen sich wirklich zu befinden, was würde allem Ansehen nach wohl die Folge hiervon sein? Wofern nicht zugleich unsere ganze Natur umgeändert wäre, so würden die Neigungen, die doch allemal das erste Wort haben, zuerst ihre Befriedigung, und, mit vernünftiger Überlegung verbunden, ihre größtmögliche und dauernde Befriedigung, unter dem Namen der Glückseligkeit, verlangen; das moralische Gesetz würde nachher sprechen, um jene in ihren geziemenden Schranken zu halten, und sogar sie alle insgesamt einem höheren, auf keine Neigung Rücksicht nehmenden, Zweck zu unterwerfen. Aber, statt des Streits, den jetzt die moralische Gesinnung mit den Neigungen zu führen hat, in welchem, nach einigen Niederlagen, doch allmählich moralische Stärke der Seele zu erwerben ist, würden Gott und Ewigkeit, mit ihrer furchtbaren Majestät, uns unablässig vor Augen liegen (denn, was wir vollkommen beweisen können, gilt, in Ansehung der Gewissheit, uns so viel, als wovon wir uns durch den Augenschein versichern). Die Übertretung des Gesetzes würde freilich vermieden, das Gebotene getan werden; weil aber die Gesinnung, aus welcher Handlungen geschehen sollen, durch kein Gebot mit eingeflößt werden kann, der Stachel der Tätigkeit hier aber sogleich bei Hand, und äußerlich ist, die Vernunft also sich nicht allererst empor arbeiten darf, um Kraft zum Widerstand gegen Neigungen durch lebendige Vorstellung der Würde des Gesetzes zu sammeln, so würden die meisten gesetzmäßigen Handlungen aus Furcht, nur wenige aus Hoffnung und gar keine aus Pflicht geschehen, ein moralischer Wert der Handlungen aber, worauf doch allein der Wert der Person und selbst der der Welt, in den Augen der höchsten Weisheit, ankommt, würde gar nicht existieren.
Das Verhalten der Menschen, so lange ihre Natur, wie sie jetzt ist, bliebe, würde also in einen bloßen Mechanismus verwandelt werden, wo, wie im Marionettenspiel, alles gut gestikulieren, aber in den Figuren doch kein Leben anzutreffen sein würde. Nun, da es mit uns ganz anders beschaffen ist, da wir, mit aller Anstrengung unserer Vernunft, nur eine sehr dunkle und zweideutige Aussicht in die Zukunft haben, der Weltregierer uns sein Dasein und seine Herrlichkeit nur mutmaßen, nicht erblicken oder klar beweisen lässt, dagegen das moralische Gesetz in uns, ohne uns etwas mit Sicherheit zu verheißen oder zu drohen, von uns uneigennützige Achtung fordert, übrigens aber, wenn diese Achtung tätig und herrschend geworden, allererst alsdann und nur dadurch, Aussichten ins Reich des Übersinnlichen, aber auch nur mit schwachen Blicken erlaubt, so kann wahrhafte sittliche, dem Gesetz unmittelbar geweihte Gesinnung stattfinden und das vernünftige Geschöpf des Anteils am höchsten Gut würdig werden, das dem moralischen Wert seiner Person und nicht bloß seinen Handlungen angemessen ist. Also möchte es auch hier wohl damit seine Richtigkeit haben, was uns das Studium der Natur und des Menschen sonst hinreichend lehrt, dass die unerforschliche Weisheit, durch die wir existieren, nicht minder verehrungswürdig ist, in dem, was sie uns versagte, als in dem, was sie uns zu teil werden ließ.